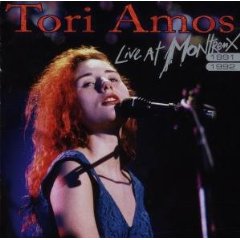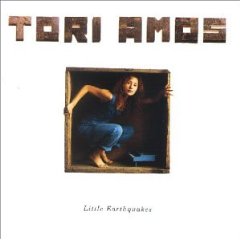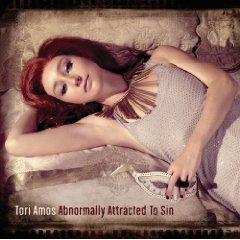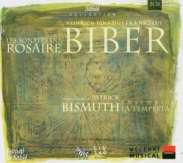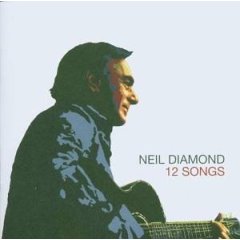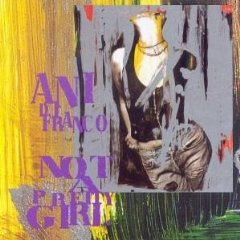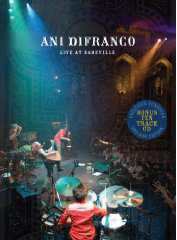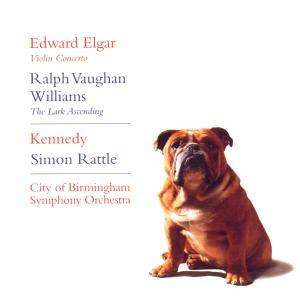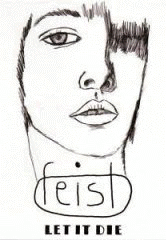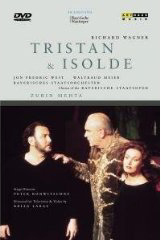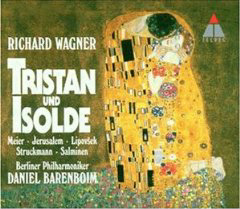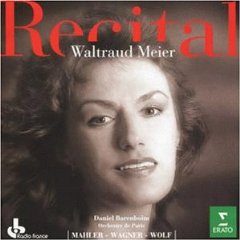Punk & Partituren
Die erst kürzlich erschienene DVD mit Live-Aufnahmen aus den Jahren 1991/92 dokumentiert Tori Amos' erste Schritte ihrer Karriere mit zwei Sets, die sie komplett solo am Klavier absolvierte. Beim Auftritt von 1991 ist sie noch völlig unbekannt; das ändert sich noch im Laufe jenes Jahres, nachdem ihr Debutalbum "Little Earthquakes" bei Kritik und Publikum auf enorm positive Resonanz stößt - beim Gig ein Jahr später tritt sie vor ein Publikum, das weiß, was es erwartet. Mußte sie zunächst auf einer Bühne spielen, die bereits für den nächsten Act vorbereitet war und mit einem (elektrischen) Fenderpiano Vorlieb nehmen, hat sie beim Auftritt ein Jahr später die Bühne für sich und einen vernünftigen Flügel zur Verfügung. Bei beiden Gelegenheiten hat sie Material von "Little Earthquake" gespielt, was eine hervorragende Gelegenheit gibt, alle möglichen Vergleiche anzustellen.
Zunächst - und obwohl ich stets Künstler und Kunst strikt voneinander trenne, läßt sich das nicht ignorieren - ist erstaunlich, in welch kurzer Zeit Amos sich von einem unsicheren Mädchen, das vor dem letzten Stück die Uhr aus der Hosentasche zieht (wohl um zu gucken, ob noch Zeit für einen Song übrig ist), dann dem Publikum eine Erklärung schuldig zu sein glaubt und fast verlegen sagt: "I pull my watch in my pocket, because it would mess up my outfit" - wie aus diesem unsicheren Mädchen eine Diva wird, die mit ausgesprochen arrogant wirkender Attitüde ein Jahr später das erste Stück kurzerhand unterbricht, um dem Publikum mitzuteilen, daß man mit dem Gequassel aufzuhören und gefälligst zuzuhören habe, und zum Schluß nur kurz den Arm hebt, in der Tür zum Bühnenausgang fast mit dem Moderator der Show zusammenrasselt, der ihr Blumen überreichen will, diese kurz angebunden noch in der Tür an sich nimmt, und ohne einen weiteren Blick entschwindet. Tori Amos steht wohl im Ruf, etwas - well: exzentrisch zu sein; hier zeigt sich, daß das erst zutage tritt, als sie Erfolg hat.
Wie auch immer: ihre Songs sind unglaublich reich an wirklich originellen Einfällen; gerade in der Harmonik wird man immer wieder von Wendungen überrascht, die völlig unüblich, aber im Nachhinein ebenso plausibel sind. Ihre Art Klavier zu spielen geht weit darüber hinaus, einfach den Gesang zu begleiten. Im Grunde steckt sämtliches musikalische Material, das sich in den Arrangements der Studioaufnahme findet, bereits in der Klavierbegleitung; im Studio wurde das Klavier stark zurückgenommen und einzelne Stimmen und thematische Einfälle über andere Instrumente verteilt.
Was sie jedoch vor allem anderen auszeichnet, ist ihre ganz außerordentliche Stimme. Was man auf dem Studioalbum hört, ist mehr oder weniger identisch mit dem, was sie auch live macht: da ist nicht eine einzige unsauber oder ungenau intonierte Stelle zu hören. Sie verfügt über zwei echte Oktaven, wobei der Übergang in die Kopfstimme sauber und unmerklich ist - wenn sie ihn nicht gerade absichtlich betont. Man findet eine schier unglaubliche Anzahl unterschiedlicher Farben, die sie kontrolliert abrufen kann: so gibt es ein Spektrum von fast unhörbarem Flüstern, bis hin zu mächtigem Druck, neben sich überschlagenden oder "sprechend" gesungenen Tönen - usf. Dabei ist das streckenweise von großer Virtuosität, mit großen Sprüngen oder mit Melismen in hohem Tempo.
Ich kannte von Tori Amos bisher nur zwei Alben aus neuerer Zeit, die ich zwar auch großartig finde, bei denen ich aber stets das Gefühl habe, daß sie dazu neigen, mit allzu großer Geste daher zu kommen, daß sie tendenziell überarrangiert sind. Ich denke, ich kann jetzt etwas genauer benennen, was mich stört: das ist Tori Amos' Verhältnis zur Ebene der Rhythmik.
Bei ihren Soloauftritten geht es definitiv nicht darum, das Publikum zu rocken: Amos entwickelt keinen Groove. Das ist zunächst überhaupt kein Qualititätsurteil (die gesamte Klassik, von wenigen Ausnahmen abgesehen, tut dies ebenso wenig) - zumal sie durchaus einen Sinn für Timing an den Tag legt, und mit einer deutlich ausgeprägten Agogik arbeitet. Bei dem Studioalbum bleibt das jedoch komplett auf der Strecke. Von einer Nummer abgesehen, die auch auf der CD nur vom Klavier begleitet ist ("Mother"), wurde komplett zum Clicktrack (i.e. gleichförmigen Metronom) aufgenommen. Das hat zunächst natürlich technische Gründe: wenn man mit dem Computer an Arrangements arbeitet, kann man an in "freier" Time aufgenommenem Material leicht verzweifeln, weil man kein "Raster" hat, anhand dessen man zusätzliches Material zeitlich ausrichten könnte. Dadurch entfällt aber jede Agogik, jede Möglichkeit also, mit leichten Verzögerungen und Beschleunigungen Bögen zu betonen und Zusammenhänge zu verdeutlichen.
Dem steht dann eine Behandlung von Schlagzeug und Percussion gegenüber, die das Desinteresse an der Rhythmik bestätigt: das sind völlig einfallslose Beats, die die Drums letztlich nur aus klanglichen Gründen einsetzen - und damit ähnlich motiviert sind wie in Marschmusik, wo Becken und Pauke dazu dienen, die Aufmerksamkeit mit Gewalt statt Überzeugung auf sich zu ziehen.
Aber ich bin gerade dabei, einen Punkt der Kritik unverhältnismäßig zu betonen. Im Moment sitze ich hier mit aufgesetztem Kopfhörer, "Winter" von den "Earthquakes" auf den Ohren, und mit der Mission beschäftigt, die Nachbarschaft endgültig gegen mich aufzubringen - meinem Mitgesinge dürfte man im Stockwerk unter mir nämlich eher kritisch gegenüberstehen.
(Die Songtexte von Tori Amos findet man u.a. hier)
Nachdem ich Little Earthquakes wieder und wieder gehört habe, bin ich auch durch (nahezu) alle anderen Alben von Tori Amos gegangen - immer wieder überrascht von völlig unkonventionellen Ideen, und wirklich begeistert vom Gesang - aber nie derart überzeugt wie vom Erstling. Das hat sich mit "From The Choirgirl Hotel" jetzt geändert.
Die Stimme allein ist es wert, die Songs immer wieder durchzuhören: die Virtuosität und frappierende Sicherheit der Intonation fällt da noch am wenigsten ins Gewicht (da mußte - den Live-Aufnahmen zufolge - im Studio nicht nachträglich gebastelt werden). Die Unzahl der Farben zwischen fast gesprochenen, gehauchten, oder glasklar gesungenen Tönen; die gestalterische Intelligenz, in mit der auch das Ein- und Ausatmen in die Gesangslinien hinein genommen und rhythmisch "richtig" platziert wird - das ist in dieser Form ohne Vorbild.
Die zwölf Songs des Albums unterscheiden sich komplett voneinander; es gibt letztlich kein Stilmittel, das allen gemeinsam zugrunde liegt - außer dem Willen vielleicht, sich auf keinen Fall zu wiederholen. Sie reichen von Computerbeats, die mit brachialem Einsatz von Kompressoren derart laut und dicht wirken, daß man zum Lautstärkeregler greifen will ("Rasberry Swirl"), bis zum Besen des Schlagzeugs begleiteten Jazzrhythmen ("Playboy Mommy)"; vom simplen Hiphop-Groove, der mir die Zähne aus dem Gesicht zieht, bis zum rhythmischen Verladebahnhof, bei dem man erst nach mehrmaligem Hinhören mitbekommt, daß der letzte Takt in einer viertaktigen Gruppe im Drei-Viertel-"Walzer" ein Viertel zu viel hat ("Spark"); von fast stehenden Arpeggien von der Celesta bis hin zu wild bewegt aufbrausendem Schlagzeuggewitter (wobei diese Kontraste in ein und demselben Stück - "Black-Dove" - versammelt sind); von ganz eigenartigen Soundexperimenten, in denen die gesamte Band in die rechte Hälfte des Raumes gesetzt wird, und auf der linken Seite ausschließlich Echo- und Halleffekte zu hören sind ("Liquid Diamonds"), bis hin zu ruhigen Nummern mit ebenso wunderschön wie unkonventionell eingesetzten Streichern ("Jackie's Strenght"); usf.
Neben den "Earthquakes" halte ich dies für Tori Amos bestes Album. Dabei gefällt mir keineswegs jeder Song in gleicher Weise - ich habe aber selbst bei dem überlauten und an Techno gemahnendem "Rhaspberry Swirl" keine Sekunde im Kopf, das jetzt mit der Fernbedienung zu überspringen - sonst nämlich würde am Kontrast zu einer Ballade wie "Northern Lad" (die mir wirklich die Tränen in die Augen treibt) etwas entscheidendes verloren gehen. Tatsächlich bildet das Album eine echte Einheit - einen dramaturgisch bewußt inszenierten Verlauf, in dem man nichts umstellen oder gar wegnehmen kann.
Ungefähr alle zwei Jahre kommt Tori Amos mit einem neuen Album heraus, und nachdem die letzten drei Werke recht poplastig daherkamen und teilweise derart eingängig waren, daß mancher Fan die Gefolgschaft aufgekündigt hatte, war ich neugierig, wohin sie ihr Weg führen wird. Um es kurz zu machen: sie hat sich wieder ihrer Ecken und Kanten besonnen, und knüpft dort an, wo sie nach dem „Choirgirl Hotel” abgebogen war.
Jeder der siebzehn Songs hat einen eigenen Charakter - Tori Amos schöpft aus einer großen Spanne unterschiedlicher Stile und bedient sich eines breiten Spektrums musikalischer Mittel. Das Album ist längst nicht so Klavier-lastig, wie man das bei ihr gelegentlich vorfindet, auch wenn ihr - wunderbar ab- und aufgenommener - Bösendorfer-Flügel eine wichtige Rolle spielt (nur eines der Stücke ist eine reine Klaviernummer). Ein Titel ist geradezu Gitarren-lastig, zwei andere leben von ihren Streicher-Arrangements. Erstaunlich oft kommen Drumloops zum Einsatz, auch wenn diese - mit einer Ausnahme - nicht das komplette Stück durchlaufen, sondern immer mit dem groovenden Schlagzeug von Matt Chamberlain (mit dem Tori schon jahrelang zusammenarbeitet) kontrastiert werden. Schließlich gibt es auch eine Reihe elektronischer Sounds, die mich meistens an analoge Oberheim-Synthies erinnern, wabernd in ganz viel Nebel.
Entscheidend ist aber, daß jedes Stück mindestens eine überraschende Wendung hat, die jede Eignung zum Hit unterminiert und das Abdudeln im Radio unwahrscheinlich macht. Das geht los bei „Give”, wo eine stark mit Effekten verfremdete Gitarre einen Ton in Viertelnoten spielt, und diesen immer wieder mit der kleinen Sekunde darunter „verdickt” - bevor Klavierakkorde dazukommen und deutlich machen, worin die harmonische Funktion der beiden Töne liegt. Das geht weiter (in „Welcome To England”) mit einer Sequenz im hohen Register der Bassgitarre, die durchlaufende Achtel zu harmonisch schwer einzuordnenden hohen Tönen aus dem Synthesizer spielt. Irgendwann wird das aufgelöst, das Schlagzeug setzt für den Drumcomputer ein, der Baß rutscht nach unten, und die Akkordfunktionen werden klar - das wirkt, als habe jemand das Fenster geöffnet und frische Luft kommt ins Zimmer. „That Guy” startet mit einem eigentümlichen Marschrhythmus und wird zunächst von gezupften Streichern begleitet, bevor das auf halber Strecke plötzlich zu einer pathetischen Hymne mit einem bombastischen Streicher-Arrangement wird. - Und so fort.
Keines der Stücke läßt sich letztlich in eine Schublade einordnen (auch wenn es in „Maybe California” eine veritable Ballade gibt, die vielleicht „Northern Lad” vom „Choirgirl Hotel” Konkurrenz machen könnte), ohne daß dies beliebig wird oder wie ein Puzzle oder eine Montage unzusammenhängender Teile klingt. Da wirkt immer eine formale Logik, in der der überraschende Kontrast auf die vorher benutzten Mittel deutlich verweist. Ich habe die CD erst einmal gehört, und den Eindruck von formaler Schlüssigkeit gewinne ich normalerweise erst nach mehrmaligem Hören (oder auch nicht) - hier hingegen ist das unmittelbar nachvollziehbar.
Eine letzte Anmerkung habe ich zu Tori Amos' Gesang. Sie ist wohl die Erste gewesen, die konsequent die Nebengeräusche des Singens gestalterisch einbezogen hat - die Atemgeräusche hat sie stets deutlich betont und rhythmisch benutzt. Davon ist hier nichts mehr oder kaum noch etwas übrig geblieben; Tori singt mittlerweile ohne Manierismen einfach und „straight”. Irgendwie fehlt mir da eine Ebene des Ausdrucks - obwohl ich mir vorstellen kann, daß sie bewußt auf ein Mittel verzichtet, das mittlerweile Jeder einsetzt.
Ich unterscheide zwischen Musikern, bei denen die Partitur der Matthäus-Passion im Bücherschrank steht und solchen, bei denen das nicht der Fall ist (das ist nur ein halber Scherz ). In meinen Augen ist dies das gewaltigste Werk der Musikgeschichte. Mit seinem Studium kann man allenfalls beginnen - und wer dies tut, wird immer wieder zu ihm zurückkehren. So kommt es, daß seit einigen Jahren Ostern mehr für mich bedeutet als bloß ein paar freie Tage.
Heute habe ich meinen Weg durchs Wochenende vorbereitet und von den unten genannten Aufnahmen den Eingangs-Chorus gehört.
John Elliot Gardiner
Bonney, von Otter, Chance, Bär u.a.
The Monteverdi Choir
The English Baroque Soloists
Deutsche Grammophon 1989
Nikolaus Harnoncourt
Schäfer, Fink, Prégardien, Goerne, u.a.
Arnold Schönberg Chor
Concentus musicus Wien
Teldec 2001
Sir Georg Solti
Te Kanawa, von Otter, Bär u.a.
Chicago Symphony Orchstra and Chorus
Decca 1987
Solti befehligt ein klassisch-romantisches Orchester, das selbst auf der Empore des Hamburger Michels kaum Platz finden dürfte. Er wählt ein langsames Tempo, nimmt die zahlreichen Staccatopunkte in der Partitur nur wiederwillig zur Kenntnis, und schraubt überhaupt an einem Klang, der gut zu Bruckner passen würde - oder eben zu jener Tradition der Bachrezeption, die das "Erhabene" in jeder Musik suchte. Ich höre die Aufnahme trotzdem gerne - allerdings in erster Linie der Sänger wegen, der lyrische Sopran von Kiri Te Kanawa rührt mich an wie kein anderer.
Harnoncourts Orchester ist kleiner (28 Streicher, im Vergleich zu den vermutlich ~40 Soltis), das Tempo etwas flotter, und - das ist der große Verzug der gesamten Aufnahme - in der doppelchörigen Anlage der Passion deutlich durchhörbar. Auch hier werden die Phrasierungen glatt gebügelt, auch hier sind die Solisten phantastisch (über Christine Schäfer gäbe es noch einiges mehr zu erzählen).
Gardiner schließlich verfügt über eine nahezu kammermusikalische Besetzung. Aus dem Booklet geht nicht genau hervor, wie viele Streicher das sind. In dem (grandiosen) Kantantenzyklus aus dem Jahr 2000 sind es vier erste, ebenso viele zweite Geigen sowie zwei Violen; die Tendenz zu dieser Reduktion ist hier schon spürbar. Die Zweichörigkeit ist im Stereobild gut nachzuvollziehen, vor allem aber: das Tempo ist hoch genug, um die Schwermut nicht mit untröstbarer Trauer gleich zu setzen. Ebenso wichtig: die Spielanweisungen Bachs werden so umgesetzt, daß Kontraste deutlich hörbar werden. Was bei Solti und Harnoncourt ein dahinfließender Brei war, bekommt bei Gardiner eine dramatische Struktur - und leitet adäquat ein Werk ein, welches sich aller im Hochbarock gängigen Mitteln der Oper bedient, um die Passion Christi den Sinnen zu verfügen.
Gleich der erste Chorus gibt eine Vorstellung von der Größenordnung, mit der wir es hier zu tun haben: es werden zwei komplette Orchester aufgeboten (jeweils 1.+2. Flöten, 1.+2. Violinen, Viola, Continuo), zwei Chöre rechts und links, sowie ein Knabenchor in der Mitte. Diese enorme Besetzung wird nicht dazu benutzt, durch Stimmverdoppelungen Wucht durch Lautstärke zu erzeugen; jede Stimme hat ihre eigene Bedeutung im polyphonen Geflecht. - Man kann diese Komplexität auf allen Ebenen wiederfinden, in der Form, dem Rhythmischen, der Harmonik (eine detaillierte Analyse bräuchte ein ganzes Buch).
Die insgesamt neunundzwanzig "Nummern" des ersten Teils sind ein loser Verbund aus Rezitativen, Arien, Chorälen, und Chören. Auf dem ersten Blick ähnelt dies dem Vorgehen in den Kantaten. Wenn man genauer hinsieht, findet man eine Gestaltung völlig fern von vorgefertigten Versatzstücken. Wo in den Kantaten häufig das Schema Rezitativ-Arie wiederkehrt, ist hier jede Abteilung eine individuelle Erfindung, selbst im Formalen. Nichts wiederholt sich, nichts wirkt nur im Entferntesten stereotyp (eine Ausnahme von dieser Aussage sind sicherlich die Choräle).
Sehr deutlich wird dies in jenen Passagen, in denen der Chor in die Rezitative montiert wird: Evangelist: "Sie sprachen aber:" - Chor (in wilder Bewegtheit): "Ja nicht auf das Fest, auf daß nicht ein Aufruhr werde"; gleich darauf wieder, der Evangelist: "sie sprachen:", der Chor: "Wozu"... (4a-d).
Ebenso deutlich jedem Schema enthoben ist die wörtliche Rede Christi: sie wird stets von Streichern begleitet; manchmal erstreckt sie sich in einer einzelnen Silbe über mehrere Noten; dadurch wird sie mehr als einmal fast zur Arie.
Noch ein Beispiel (um nur bei den Rezitativen zu bleiben): Nr.19 bringt einen pulsierenden 16tel-Baß im Continuo (gegen den Usus, den Sänger mit wenigen Einwürfen zu begleiten), in den dreimal ein Choral montiert wird.
In dieser Weise könnte ich stundenlang weiter machen. Wenn man auf formaler Ebene alles gesagt hat, könnte man die harmonische Ebene untersuchen. Schließlich könnte man sich Rhythmik und Phrasenbildung genauer anschauen, um nochmals über zahllose Wunder zu stolpern.
Was mich aber am meisten fasziniert, ist die Art und Weise, in der diese allerhöchste Handwerkskunst daherkommt: sie steht nämlich völlig im Dienst der Sache. Ich finde hier keine leeren Tricks und kein virtuoses Blendwerk - mir scheint jede Note einem Zweck zu dienen, nämlich der Vermittlung des Textes.
Einige - eher ungeordnete - Notizen.
- Berühmt ist ja der Choral "O Haupt voll Blut und Wunden", der insgesamt fünfmal wiederkehrt. Ich habe schon seltsame Zahlenmystik über die Tonarten gehört - aber aus der Folge: E, Es, D, F, C kann ich beim besten Willen nichts Ungewöhnliches entnehmen.
- Gardiner verzichtet in drei Arien (Nr.52,60,65) auf füllende Akkorde im Continuo. M.E. ist das ein Fehler. Die Außenstimmen machen zwar den Harmonieverlauf klar, sind aber dann von genauester Intonation abhängig - und an der letzten Präzision hapert es dann doch.
- Ein wunderbares Beispiel für die Fähigkeit der Barockmusik zur Schilderung von Natur findet sich in 63a: "Der Vorhang im Tempel zerriß in zwei Stück [...] und die Erde erbebete". Der Text wird ausschließlich vom Continuo begleitet - und die rasenden Baßläufe und vertrackten harmonischen Wendungen illustrieren das Geschehen ebenso adäquat wie ein wagnersches Orchester.
- Ein Tip zum Reinhören verbietet sich, man muß das Werk im Ganzen zur Kenntnis nehmen (Baßarie, Nr.65).
Ludwig Güttler
Genz, Oelze, Markert, Junhanns, Scheibner
Hallenser Madrigalisten
Virtuosi Saxoniae
Edel Records 1998
Die Johannes-Passion ist gewissermaßen die "kleine Schwester" der Matthäus-Passion: sie ist etwa ein Drittel kürzer und wesentlich stärker auf den Text der Bibel konzentriert. Im wesentlichen wird sie getragen vom Vortrag des Evangelisten, dessen: "er sagte:" die Gelegenheit bietet, eine andere Stimme für die wörtliche Rede einzufügen. Kontrastiert wird dies von Chorälen, Chören, und Arien - allerdings recht weit entfernt von den ausschweifenden Exkursen, die die Matthäus-Passion auszeichnet.
Die vorliegende Aufnahme ist ein Musterbeispiel für Reduktion: jede Stimme des Orchester ist solistisch besetzt; die Größe des Chores ist nicht dokumentiert, ich denke, das sind vielleicht 20 Sänger.
Alle Beteiligten musizieren ausnahmslos auf höchstem Niveau. Zwei Sänger will ich hervorheben: Christiane Oelze, die ich für eine Ausnahmebegabung unter den jungen Sopranistinnen halte; und Christoph Genz, dessen Name mir bisher unbekannt war, der aber über einen unglaublich klangschönen, in den Höhen nie metallischen wie auch in mittlerer wie tiefer Lage klar definierten Tenor verfügt.
Anspieltip (den ich eigentlich nicht geben mag): Baßarie mit Chor, Nr.60.
Ich habe gerade damit begonnen, mich durch Thomas Manns „Doktor Faustus” zu arbeiten - in der Hoffnung, dort Material für meinen Handwerker und Genies-Baukasten zu finden. Der Roman ist 1943 im amerikanischen Exil entstanden, und sein Thema setzt sich genau mit jener Doppelbödigkeit des Geniekults auseinander, an der er zu jenem Zeitpunkt zerbrechen will, und mit der ich mich gerade beschäftige. Thomas Manns Ich-Erzähler erklärt, der Zeit der Romantik noch nicht entronnen zu sein und ihr Pathos nicht missen zu wollen. Gleichzeitig wird schon zu Beginn klar, daß die Hauptfigur - der Komponist Adrian Leverkühn, um den die fiktive Biographie sich dreht - sie haßt und verspottet: er lehnt das Wort von der „Inspiration” glattweg ab, und will sich nicht einmal mehr „Künstler” nennen lassen. - Ich kenne vom Roman nicht einmal eine Synopsis, und lasse mich von dem überraschen, was da kommt.
Dabei hatte ich all die Jahre bisher - mehr oder weniger erfolgreich - einen Bogen um das Werk Thomas Manns geschlagen. Seine Sprache, die zumeist in gedrechselten, verschlungenen und überlangen Sätzen daherkommt, kam mir bisher verdächtig gemacht und bemüht vor, und das Tempo, in dem seine Erzählungen sich entwickeln, erschien mir außerordentlich langsam, ja stockend und zäh.
Nach den ersten zwanzig Seiten im „Doktor Faustus” mußte ich mich zwingen, am Ball zu bleiben. Nach weiteren zehn Seiten wollte ich das Buch in die Ecke pfeffern. Nochmal zehn Seiten später fiel mir dann auf, das ich jeden Satz nicht fünfmal, sondern nur noch zweimal lesen mußte. Mittlerweile habe ich mich soweit eingelesen, daß ich nahezu jeden Satz auf Anhieb entschlüsseln kann und ebenso flüssig vorankomme wie mit jedem anderen Roman auch. Und plötzlich macht das richtig Spaß - zumal Thomas Mann hier von Musik in einer Art Weise spricht, wie ich das sonst nicht kenne.
Da gibt es ein Kapitel, in dem Leverkühns Lehrer Beethovens Klaviersonate op.111 - die 32. und letzte - erklärt und analysiert. Thomas Mann gibt hier eine brillante Deutung des Werks, die sich über mehrere Seiten erstreckt, und mich eben dazu gebracht hat, die CD heraus zu kramen und das Stück anzuhören. Im Klavierwerk Beethovens kenne ich mich nur oberflächlich aus, und ich bin gar nicht sicher, ob ich op.111 zuvor schon einmal gehört habe. Das habe ich eben nachgeholt - wobei sich herausstellte, daß ich nicht nur eine CD (mit einer Interpretation Alfred Brendels), sondern auch die Noten besitze. Tatsächlich ist das ein wirklich gewaltiges Werk, und der letzte Satz, der aus Variationen über eine schlichte, harmonisch völlig konventionelle Arie besteht, gehört womöglich zum Besten, was Beethoven geschrieben hat.
Thomas Mann schreibt über das Arietto u.a.:
Das Charakteristikum des Satzes ist ja das weite Auseinander von Baß und Diskant, von rechter und linker Hand, und ein Augenblick kommt, eine extremste Situation, wo das arme Motiv einsam und verlassen über einem schwindelnd klaffenden Abgrund zu schweben scheint - ein Vorgang bleicher Erhabenheit, dem alsbald ein ängstliches Sich Klein Machen, ein banges Erschrecken auf dem Fuße folgt, darüber gleichsam, daß so etwas geschehen konnte. Aber noch viel geschieht, bevor es zu Ende geht. Wenn es aber zu Ende geht und indem es zu Ende geht, begibt sich etwas nach so viel Ingrimm, Persistenz, Versessenheit und Verstiegenheit in seiner Milde und Güte völlig Unerwartetes und Ergreifendes. Mit dem vielerfahrenen Motiv, das Abschied nimmt und dabei selbst ganz und gar Abschied, zu einem Ruf und Winken des Abschieds wird, mit diesem d-g-g geht eine leichte Veränderung vor. […] Es ist wie ein schmerzlich liebevolles Streichen über das Haar, über die Wange, ein stiller, tiefer Blick ins Auge zum letzten Mal. Es segnet das Objekt, die furchtbar umgetriebene Formung mit überwältigender Vermenschlichung, legt sie dem Hörer zum Abschied, zum ewigen Abschied sanft ans Herz, daß ihm die Augen übergehen.
Genau so ist es.
Die gestern erwähnte Klaviersonate op.111 von L.v.Beethoven kenne ich in einer Aufnahme mit Alfred Brendel. Es gab irgendwann eine Doppel-CD für wenig Geld, auf denen die letzten sechs Klaviersonaten versammelt sind. Die Aufnahmen stammen aus den 70er Jahren - das klingt schon ein wenig muffelig und hat eine reduzierte Dynamik, ist aber für Klavier solo durchaus erträglich. Die Interpretation Brendels ist gewohnt sachlich - er spielt die Noten so, wie sie auf dem Blatt stehen (was keineswegs eine Selbstverständlichkeit ist).
Ich habe heute eine aktuelle Aufnahme dagegen gestellt, und zwar die Einspielung von András Schiff für ECM aus dem letzten Jahr. Die Aufnahmequalität ist exzellent, wie ich das von ECM auch nicht anders erwartet hätte. Das Klavier ist in sämtlichen Lagen klar durchhörbar, was bei den extrem zwischen Diskant und Bass auseinander gerissenen Passagen einen komplett anderen Eindruck erzeugt, als das bei den Brendel-Aufnahmen der Fall war - man hört jetzt plötzlich die Akkorde, wo vorher nur ein ungefähres Murmeln wahrnehmbar war.
Auch und gerade die Interpretation von András Schiff finde ich überzeugend. Er wählt durchgehend zügige Tempi, was gerade dem letzten Satz von op.111 zugute kommt. Wo Brendel fast unerträglich langsam ist, bekommt man bei Schiff auf Anhieb den Puls des 9/16-Taktmaßes zu fassen, und kann - auch ohne Noten zu lesen - nachvollziehen, wie Beethoven in den ersten drei Variationen langsam und allmählich die rhythmische Dichte erhöht, bis sie in der vierten plötzlich in ein impressionistisches Flirren zerfließt. Die Vorschriften für forzati und subito-fortes werden durchaus ernst genommen, ohne daß den Akzenten mit entsprechender Agogik neben ihrer rhythmischen Funktion noch zusätzlich Bedeutung mitgegeben wird - das ergibt eine geradezu reinigende Wirkung, die die Patina der romantischen (oder romantisierenden) Tradition gründlich entfernt.
Alles in allem ist das ein bemerkenswert unaufgeregtes Herangehen an ein von Legenden umwittertes Werk, bei dem die Struktur der Stücke offen gelegt wird, ohne neue Geheimnisse zu erfinden (ich wollte eigentlich sagen: Schmalz an die Sache heranzutragen). Schiff hat übrigens sämtliche Klaviersonaten Beethovens eingespielt - ich werde da sicherlich noch die eine oder andere CD anschaffen (auch wenn die mit je knapp €20,- nicht gerade billig sind).
Im lesenswerten Booklet gibt Schiff noch im Gespräch eine recht ausführliche Analyse der unterschiedlichen Stücke - und verweist hier natürlich prompt auf die Beschreibung von op.111 in Thomas Manns Doktor Faustus. Ich bin da offenbar nicht der erste, der die Stringenz und Stimmigkeit der Mann'schen Darstellung bewundert.
Sir Colin Davis
London Symphony Orchestra
LSO Live, 29-30.9.2000
Hector Berlioz (1803-69) gehört zu den originellsten Gestalten der Musikgeschichte. Als Siebzehnjähriger hat er, aus der Provinz nach Paris kommend, erstmals ein Orchester gehört. Zehn Jahre später trat er mit einem Orchesterwerk an die Öffentlichkeit, das gleich auf mehreren Ebenen bis dato völlig unerhört war.
Das Jahr ist 1830. Beethoven ist vor drei Jahren gestorben. Richard Wagner mit seinen Siebzehn lernt noch, und Franz Liszt hört Berlioz' Werke, freundet sich mit ihm an. Bis die Neudeutschen sich finden, wird noch Zeit vergehen.
Wenn man sich den zeitlichen Bezug klarmacht, kommt man beim Hören der Symphonie fantastique nicht aus dem Staunen heraus:
Von der Einspielung durch das London Symphony Orchestra kann ich - wie von allen Aufnahmen unter Sir Colin Davis - nur schwärmen: das ist, quer durch alle Instrumentengruppen, auf höchstem technischem wie musikalischem Niveau. Auch die Aufnahmetechnik ist von einer kaum zu schlagenden Qualität: wer nicht glauben kann, daß man ein komplettes Orchester ins Wohnzimmer verfrachten kann, wird hier eines Besseren belehrt.
Heinrich Ignaz Franz Biber lebte von 1644-1704, also recht genau eine Generation vor jener J.S.Bachs. Dabei markiert er nicht einmal den Beginn des Barock, den man allgemein knapp fünfzig Jahre vor seiner Geburt mit den Opern Monteverdis (um 1600) verbindet. All das, was unter Barockmusik subsumiert wird, umfaßt also einen Zeitraum von fast genau 150 Jahren - es ist da kein Wunder, wenn man über völlig unterschiedliche Musik stolpert, die außer dem Etikett kaum etwas teilt.
Die Rosenkranz-Sonaten sind für Solovioline und begleitendes Continuo, wobei die Saiten der Violine in jeder Sonate anders gestimmt werden - "Scordature", lautet das Zauberwort. Dadurch werden Doppelgriffe und Arpeggien möglich, die auf einer "traditionell" gestimmten Violine schlicht nicht machbar sind. Was Biber da dem Solisten an Virtuosität abverlangt, ist umso bewundernswürdiger, als es nie um Effekte geht.
Zum einen findet man in der Analyse der Sätze eine Zahlensymbolik, die - obwohl sehr verbreitet und üblich in dieser Epoche - angeblich nicht ihresgleichen hat:
In der Christi-Geburt-Sonate (III) dominiert die Nummer 13 (der vor der Aufklärung nichts Negatives anhing). Gesamtzahl der geschriebenen Noten: 1014 = 6 x 132. Zahl der geschriebenen Violin-Noten: 767 = 4 x 132 + Dreieck von 13, Zahl der geschriebenen Basso Continuo-Noten: 247 = 2 x 132 - Dreieck von 13.[usf.]
(Aus den Liner-Notes)
Zum anderen aber ist dies höchst unterhaltsam zu hörende Musik, die in harmonischer Frische und starker Anlehnung an Tanzformen fast unbekümmert daher kommt.
Wer von der Popmusik unserer Tage gelangweilt nach Alternativen sucht, gleichzeitig aber nichts mit dem Fetisch der Klassikfraktion mit ihren Opernpremieren und abgedunkelten Konzertsälen zu tun haben will, könnte es hier mal versuchen: das ist die Popmusik, wie sie vor gut 300 Jahren gespielt wurde. Die richtet sich zwar nicht an die Öffentlichkeit, wie Pop das tut; ihr Publikum ist jedoch ungleich größer, denn ihr soll nur einer applaudieren, der Schöpfer höchstpersönlich.
Ernst Bloch (1880-1959) gehört zu jenen Komponisten, die man nicht recht als Spätromantiker einordnen und erinnern mag, die aber dem 19.Jh auch nach dem zweiten Weltkrieg noch verhaftet blieben und so allenfalls als Eklektiker und Epigonen wohlwollend beiseite gelobt werden - wenn man sie nicht gleich als rückschrittliche Geister vertreiben will.
Die Es-Dur-Sinfonie gehört zu seinen Spätwerken, und ist hörbar beeinflußt von all dem, was Gustav Mahler und seine Nachfolge hervorgebracht haben. Das Scherzo (2. Satz) scheint wie eine Replik auf die Verhuschtheit des Mittelsatzes von Mahlers Siebter, unter Kenntnisnahme von Alban Bergs Antwort in der Lyrischen Suite. Der erste Satz kommt mit einer Zwölftonreihe im Thema daher (ich beziehe mich auf das Booklet, ohne Kenntnis der Partitur), beginnt jedoch mit einem Adagio, welches eine Quinte aus Es-B mit einem G zum Es-Dur-Dreiklang füllt (als wenn das ein Brucker-Zitat werden wollte).
Wirklich bewegend fand ich den langsamen Satz: was an Wohlklang trotz härtester Dissonanzen möglich ist; wie man sich in der Tradition Wagners immer weiter aus dem tonalen Rahmen herauslehnen kann, ohne ihn letztlich zu brechen - das wird hier vorgeführt, und verursacht bei mir einen Kloß im Hals.
Der letzte Satz ist eine fröhlich-dissonante Auskehr - der allerdings in den letzten Sekunden das Pathos des langsamen Satzes wieder aufnimmt. Der Schluß trumpft nicht auf - wie man das von Mahler & Co. gewohnt ist - sondern verweht.
Dies ist nur ein erster Eindruck. Ich habe das Werk heute zum ersten Mal gehört, und kenne nicht einmal die Noten - aber es könnte sich einer näheren Auseinandersetzung lohnen.
Berliner Philharmoniker
Günter Wand
RCA
Gelegentlich bin ich von anderen Dingen derart absorbiert, daß ich beim Hören von Musik abgelenkt bin, ständig gedanklich abschweife, schließlich sogar auf meine abendlichen Konzerte verzichte. Dann hilft immer eines: eine Breitseite Bruckner.
Mir ist völlig klar, daß Anton Bruckners Sinfonien keineswegs den Höhepunkt der abendländischen Musikgeschichte darstellen. Dennoch erzeugen sie bei mir einen Sog, dem ich mich nicht entziehen kann - und dies auch gar nicht will. Die - sehr speziellen, brucknertypischen - Modulationen erzeugen bei mir regelmäßig eine Gänsehaut, und wenn es laut wird, kullern auch mal ein paar Tränchen.
Um solche Emotionen zuzulassen, muß ich allerdings klar unterscheiden: zum einen gibt es jenen Bruckner, der ewig an den eigenen Sachen herum gedoktert hat, nachdem ihm der angedachte Dirigent für die Uraufführung bedeutete, daß es so ja überhaupt nicht ginge; der von Gustav Mahler für das Publikum des Fine de Siêcle zurecht gerückt wurde mit Uminstrumentierungen im Sinne des wagnerischen Mischklangs; der von Furtwängler in den Dreißigern schließlich als Zeuge der Ideologie der Nazis inszeniert wurde und für lange Zeit in Verruf geriet. Zum anderen aber - und Günter Wand kann man es gar nicht hoch genug anrechnen, dieses zu Tage gefördert zu haben - findet man in der Originalfassung der Partituren wahre Wunder an Klarheit und Prägnanz, und zwar auch und gerade dort, wo es "dünn" klingt, oder große Einfachheit zunächst "einfältig" erscheint.
Für mich kristallisiert sich Bruckners Fünfte immer klarer als sein stärkstes Werk heraus. Beim ersten Hören war ich sofort vom Finale hingerissen - wer an Bach geschult ist, hat keine Probleme, den Aufbau der Doppelfuge auf Anhieb nachzuvollziehen. Die erste Bewunderung hat sich nur noch weiter verstärkt, als ich kapierte, was Bruckner da harmonisch zaubert - und was er über mehrere lange Expositionen an Zauberei auch in der Waage zu halten vermag.
Auch die anderen Sätze sind deutlich entfernt von dem Schematischen, das seinen anderen Sinfonien gelegentlich anhaftet. Der erste Satz startet mit einer langen Introduktion, die derart eigenständig daher kommt, daß sie im ersten Satz variiert wird, und im Finale nochmals auftaucht. Das Scherzo ist eine fast übermütige Mischung aus wagnerischer Blechbläser-Angegeberei und Wiener Walzerseeligkeit. Im Adagio kontrastiert eine monophone, von zwei in verquer-verkopfter Rhythmik getrennten Stimmen vorgetragene Linie mit einem Thema, dessen spätromantische Sehnsucht an jene Schuberts erinnert.
Aber all das geschieht vor dem Höhepunkt - und ich müßte jetzt auf technische Kategorien zurückgreifen, um noch etwas zu sagen, statt mich einfach bloß - als Fan - in Lobeshymnen zu ergehen (ich sollte mal versuchen, eine Analyse der Doppelfuge des letzten Satzes so zu schreiben, daß sie technisch korrekt ist, und trotzdem auch für einen Nicht-Akademiker verstehbar bleibt).
Am letzten Tag der Woche findet sich auf der letzten Seite der SZ eine ihrer besten: das Interview zum Wochenende. Diesmal befragte Alexander Gorkov Neil Diamond (im Wochenend-Interview ist der, der die Fragen stellt, so wichtig wie der, der sie beantwortet).
Ich war schon sehr überrascht: einmal davon, daß Neil Diamond eben kein Künstlername ist, sondern – in jenem jüdischen Milieu, in dem er aufwuchs – ein langweiliger Spießername; dann davon, was für eine facettenreiche Persönlichkeit sich hinter dem Mann verbirgt. Das ist keinesfalls der halbe Schlagersänger, für den ich ihn immer gehalten hatte, sondern eine reflektierte Person mit dezidierten Standpunkten.
Man muß wissen: ich bin mit „Neil” groß geworden; meine Schwester war (und ist!) ein großer Fan, und hat dafür gesorgt, daß in meiner Teenagerzeit im Nebenzimmer stets seine Musik spielte. Insofern ist es fast ein Wunder, daß ich mir soeben die "12 Songs" in voller Länge gegeben habe – das Interview war interessant genug, mein festgestanztes (Vor)urteil in Neugierde zu verwandeln.
Die CD besteht komplett aus Neukompositionen – was bei einem Star wie Diamond, der die Sechzig längst überschritten hat, und von dem man vermuten könnte, daß er seine Konzerte mit abgenudelten Hits vergangener Tage bestreitet, mehr als ungewöhlich ist. Die zweite, nicht minder große Überraschung: hier wird akustische Gitarre gespielt, und gesungen. Wenig mehr. Kein Zuckerguß aus Streichern und Chören, sondern eine ehrliche Bilanz: dies ist meine Stimme (und da wurde nicht mit dem Computer nachträglich an der Intonation geschraubt; ich weiß, wie sich sowas anhört), so klingt meine Martin-Akkustik, und wenn ich die Tonart wechseln will, setze ich ein Capo auf das Griffbrett.
Der Produzent heißt Rick Rubin, und der ist in der Szene ja kein Unbekannter. Der Reichtum an Details dürfte auf sein Konto gehen: das Xylophon, das in einem (zwei?) Songs die hohen Frequenzen besetzt; die Slide-Guitar, die über die Akkustischen überfallsartig hereinbricht; kurz ein Cello, eine Tuba, ganz kurz eine komplette Marching-Band (die Credits auf der CD sind alles andere als komplett) – das ist mehr als bloß Handwerk, Rubin bekundet ein echtes Interesse an Diamonds Songs.
Meine Favoriten: das freche "Save me a Saturday Night" (das in Es-Dur aus dem üblichen Gitarren-Tonarten ausbricht), "I'm On to You" (düster), und – voller Pathos – "Create Me".
Überflüssig: die beiden Bonustakes. Besonders die letzte Nummer sollte man sich – zumindest beim ersten Hören – schenken; das klingt, im Kontext, doch reichlich nach Party.
Na – und ich muß es doch loswerden: glücklicherweise ist mein Englisch nicht gut genug, um jedes Wort auf Anhieb zu verstehen – leider aber auch nicht ganz so schlecht, daß ich nur die groovende, textlose Seite dieser Songs wahrnehme.
Ani DiFranco, Jahrgang 1970, Sängerin und Gitarristin, ist seit fast zwanzig Jahren im Geschäft, ihr Debutalbum erschien 1990. Auch "Not a Pretty Girl" ist schon etwas älter und stammt aus dem Jahr 1995 - dabei ist es alles andere als verstaubt, im Gegenteil.
Auf dem Album hört man akustische Gitarre - drei(?) von den vierzehn Songs sind ausschließlich von ihr begleitet -, und Schlagzeug; gelegentlich kommt eine Baßgitarre dazu, an ganz wenigen Stellen noch E-Gitarre, eine zweite Stimme, oder Geräuscheffekte. Wenn ich das vorher gewußt hätte, hätte ich die CD wohl nicht gekauft - selbst die Solo-Auftritte Melissa Etheridges finde ich, mit dem ewig-gleichen Geschrengel von der Gitarre im Hintergrund, nach kurzer Zeit langweilig - von anderen Sängern ganz zu schweigen.
Ich hatte also das Glück des Nicht-Wissenden. Mir wäre nämlich sonst einiges entgangen.
Der eigentliche Star der Aufnahmen ist die Gitarre. Was DiFranco mit ihr anstellt, habe ich in dieser Form noch nicht gehört: das ist Rhythmusarbeit - ohne jedes Solo - von einer Virtuosität, von der ich erst nicht glauben konnte, daß sie möglich ist. Ich vermute, daß die meisten Hörer der Meinung sind, daß hier mit endlosen Overdubbs, mit mindestens zwei Gitarren gearbeitet wird - ich habe selber erst im Booklet nachgeschaut in der Überzeugung, daß da wohl ein zweiter Gitarrist mitmacht. Nein: das ist, bis auf wenige Ausnahmen, genau eine Gitarre - die zwar mit Mitteln der Aufnahmetechnik so laut in den Vordergrund gemischt und äußert "dick" daherkommt, wie das "Live" nicht möglich wäre, die aber eben nicht aus mehreren Takes zusammengestückelt wurde (ich habe an einigen Stellen länger überlegen müssen - aber es geht, es ist realisierbar, auch wenn es höllisch schwer ist). Ich habe DiFranco noch nicht live gesehen, aber ich vermute stark, daß sie zu diesen ganzen Kunststücken überdies noch gleichzeitig singt.
Dabei ist dies kein Virtuosentum um seines selber willen. Die meisten Stücke sind formal sehr einfach, mit meist zwei Teilen, die zudem noch sehr ähnlich gestrickt sind. Es geht immer wieder um kurze, zwei- oder viertaktige Patterns, die ständig wiederholt werden und in erster Linie durch ihre rhythmische Prägnanz wirken. - Ich sage es mal anders: das geht ab wie die Pest, aller Heavy-Metal ist ein armseliges Geschrammel im Vergleich zu der Power, die hier von einer einzelnen Akustischen ausgeht. Es wird hier eben nicht einfach irgendeine Belanglosigkeit möglichst laut heraus geschrien, sondern durchaus komplexe rhythmische Einfälle in gnadenloser Genauigkeit abgefeuert und in groovende Spannung versetzt.
Mit von der Partie ist ein kongenialer Kollege am Schlagzeug. Andy Stochansky war mir bisher unbekannt - ich werde mir den Namen aber für die Zukunft merken; er gehört m.E. in die Liga der großen Studiodrummer - in Augenhöhe mit Jimmy Keltner oder Manu Katche -, die nicht versuchen, mit möglichst spektakulärer Technik zu glänzen, sondern ihre Klasse schon in dem Moment zeigen, wo sie nur die Bassdrum auf 1+3 und die Snare auf 2+4 bedienen (in Reinform zu bewundern in "Shy").

Mich würde sehr interessieren, wie die Aufnahmen entstanden sind (die Aufnahmetechnik verdient eigentlich einen eigenen Eintrag in meinem Blog: so, wie dort jedes Detail eingefangen und in einen äußerst klar gezeichneten Raum gestellt wird, wird das zu einer echten Referenzaufnahme zum Testen von Boxen und Verstärkern). An einigen Stellen wurde - klar erkennbar und durch nichts verschleiert - gedubbt; ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, daß man hier die klassische "Schichttorte" aufgeführt - d.h. erst Schlagzeug, dann Gitarre, und erst im letzten Durchgang den Gesang aufgenommen - hat. Ich vermute, daß zumindest Schlagzeug und Gitarren"begleitung" in einem Rutsch gemeinsam aufgenommen wurden - anders kann ich es nicht erklären, wie phänomenal groovend das zusammengeht.
Musik und Text - das ist ein Thema, mit dem ich mich nur ungern auseinandersetzen mag. Musik hat, in meiner Wahrnehmung, eine ganz eigene Wirklichkeit, in der die konkreten Aussagen, die Sprache macht, oft wie Fremdkörper wirken (insofern habe ich zum gesamten Genre der Oper ein zwiespältiges Verhältnis - ein Thema, bei dem ich noch mehr zögere, mich zu äußern). Manchmal bin ich richtig dankbar, wenn im englischsprachigen Pop so genuschelt wird, daß ich kein Wort verstehe - oder wenn, wie bei Feist, mit Dadatexten gearbeitet wird, die sich einem konkreten Sinn verweigern.
Bei Ani DiFranco sieht das etwas anders aus. Ihre Texte sind längst keine reine Lyrik, die ohne Musik Bestand hätte; trotzdem haben sie eine Qualität, die deutlich über die Rolle hinausweisen, dem Chick Singer Worte in den Mund zu legen, mit denen er seine Melodie singen kann.
Einer ihrer bekannteren Songs thematisiert ihr eigenes Business, in dem man vor der Entscheidung steht, sich dem Establishment der Plattenindustrie anzuschließen, mit der Absicht, ein großes Publikum zu erreichen, oder - wie Ani dies tut - auf seiner Unabhängigkeit zu insistieren, in der Hoffnung, die Bodenhaftung nicht zu verlieren:
and i wonder when you're a big starDenn, so ihre lakonische Einsicht - deren Formulierung einem freilich erstmal so einfallen muß:
will you miss the earth
everyone is a fucking napoleonIn den meisten Folksongs geht es um Liebeszeug, und an diesem Thema kommt auch Ani nicht vorbei (wie auch sollte das gehen). Im Titelsong des Albums heißt es:
every song has a youMan könnte erwarten, daß das der Refrain wäre - der aber wird hier verweigert (zumindest im Text; die Musik ist anders - fast schon am Text vorbei - organisiert). Statt dessen wird eine Geschichte erzählt, deren Wendepunkt so lautet:
a you that the singer sings to
and you're it this time
baby, you're it this time
i just want you to live up to
the image of you i create
i see you and i'm so unsatisfied
i see you and i dilate
Das kann natürlich nicht gut gehen, und der Schluß beschwört eine Poesie der Einsamkeit, die mich wirklich (wirklich) anrührt:
the world is my oysterEin letztes Beispiel: in "Adam and Eve" klingt das Liebesgeplänkel eher nach einem One-Night-Stand; auch das kann wehtun und Folgen haben, was aber voraussehbar wäre, wenn man die biblischen Figuren nur richtig deutet:
the road is my home
and i know that i'm better
off alone
i did not design this game
i did not name the stakes
i just happen to like apples
and i am not afraid of snakes
"Living in Clip" ist eine Doppel-CD, mit Aufnahmen von Liveauftritten im Zeitraum 1995/96. Ich hatte ja schon die Vermutung geäußert, daß Ani DiFranco zu ihrer furioser Gitarrenarbeit auch noch gleichzeitig singt - hier ist die Bestätigung. Nicht nur das: sie gab damals ihre Konzert in einer Triobesetzung, in der zu ihrer Gitarre+Stimme lediglich Baß und (das von Andy Stochansky freilich grandios gespielte) Schlagzeug hinzu kamen. Das ist jetzt keine typische Klampfenmusik, wo zu Dauergeschrengel nette Liedchen geträllert werden: das ist hochintelligenter Volldampf-Rock, bei dem das Publikum hörbar außer Rand und Band gerät.
Ani produziert - seit ihren ersten Anfängen - ihre Platten selber und veröffentlicht sie auf ihrem eigenen Label; auf jeder CD steht der schöne Satz: "unauthorized duplication, while sometimes necessary, is never as good as the real thing" (und angesichts der aufwändig gestalteten Booklets stimmt er auch) - daher denke ich, es geht ok, wenn ich sie selber sprechen lasse, und die (fast) kompletten Liner-Notes abschreibe.

nothing on this album was overdubbed. there's the occasional sampling (accounting for the phenomenon of two anis singing at once) which, with the exception of the of the track WRONG WITH ME, occurred live at the shows. at the sound board, andrew would sample my voice on the fly, loop ist, and send it back through the PA, so i could harmonize with myself on stage (ex: WHATWEVER). on WRONG WITH ME i grabbed snatches of my guitar groove and vocal preamble to IN OR OUT, looped them, and just sorta reinvented the introduction to the song. but as far as overdubbing, there's only one exception. we redid the vocal on the orchestral version of BOTH HANDS because the original track had so much line hum and high-pitched electrical interference, it would've made your teeth itch and your dog howl.
'course a lot of the hiss and hum we just to accept and leave in. we recorded without using compressors, and unsupervised ADAT taping of live performances is not ideal, after all. we had 8 tracks to work with (except HIDE AND SEEK and TIPTOE which were on DAT), most of which were dominated by andy's goddam crash cymbal and the incessant screaming of the front 10 rows.
but hey, we wouldn't want the performance of the machines to outdo the little people on stage, what with their missed chords and beats and flubbed changes... so if the chick singer is not singing the right words, don't adjust your set, just revel in the beauty of live performance.
you can hear all the right words on the studio albums, if you want, but the songs won't sound nearly as much like themselves as they do here. I've never been a studio musician, very few folksingers are, i think. we travel. we play music for people, not posterity. no permanence. no perfection. there are those who turn knobs and make magic and there are those who turn up and try to make a living. these recordings represent a handful of the suspect situations (orchestra, anyone?) and ludicrous venues that i followed my guitar into, in the past year... baroque, sculpted theatres and dark, skanky rock clubs. hockey stadiums and airplane hangers, tents, ballrooms, and sweaty basement bars where i could smell the audience (and vice versa, god forbid).
speaking of which. the audience wasn't miked on these recordings. all the audience sound you hear is what picked up by my vocal mic (in case you wonder what i hear). on some of the songs, we muted all the tracks exept for the guitar pickup at the end so you can just hear the audience vibrating through it (in case you wonder what my guitar hears).
and to the audience i've got two things to say:
1. next time, shut the fuck up!
2. thank you, thank you, thank you
thank you for driving hours and hours to get to the show, amassing speeding tickets along the way. thank you for for waiting around in the cold before doors. thank you for the tapes, the poetry, the cookies... thank you for listening to my sorry ass. i remember my life before you would come around, it was bleak. i owe my job to you, and i owe my life to my job.
Um es im Deutsch der Goethe-Zeit zu sagen: welch hoher Geist und stolzer Sinn!
Die DVD dokumentiert ein Konzert, das Ani DiFranco vor gut einem Jahr in Buffalo, N.Y., gegeben hat, zeigt also, wo sie momentan in ihrer künstlerischen Entwicklung steht. Sie spielt darauf Songs aus ihrer gesamten Karriere, so daß man einen ganz guten Eindruck davon bekommt, in welchen Ecken sie sich umgeschaut hat.
Schauplatz des Konzerts ist - und schon allein das ist eine Story, die ich gern mal in der Zeitung lesen würde - ein 135 Jahre altes Gebäude, das ursprünglich als methodistische Kirche diente, dann lange leer stand und kurz vor dem Verfall war, bevor es Anis Plattenlabel gekauft und renoviert hat. Righteous Babe Records hat heute dort nicht nur seine Büros, sondern auch einen eigenen Veranstaltungsort.
Die Band besteht aus geschätzt sechs Leuten - Kontrabaß, Vibra- bzw. Marimbaphon, einem von Allison Miller excellent gespielten Schlagzeug, und Ani, die allein drei Musiker stellt: die Sängerin, sowie mindestens zwei parallel spielende Gitarristen. Man glaubt es eigentlich erst, wenn man es sieht (und auch dann vermutetet man noch irgendein hinzugemischtes Playback vom Tonband): was diese Frau auf der Gitarre drauf hat, ist schon ganz unglaublich. Das gilt sowohl für die Technik zumal der rechten Hand (sie hat, was ich schon vermutetet hatte, Fingerpicks auf sämtlichen(!) Fingern), als auch für diese stupende Sicherheit, mit der sie die Grooves einfach rollen läßt, und nebenbei dem Publikum irgendwelche Storys über die Geburt ihrer Tochter erzählt.
Der Höhepunkt der DVD findet sich dann (m.E.) auch in den beiden unbegleiteten Stücken, wo sie es hinbekommt, ein voll besetztes Haus mit einer von einer einsammen Gitarre begleiteten Up-Time-Nummer zum Ausrasten zu bekommen ("Shy") - ich kenne keinen zweiten Musiker, dem ich dieses Kunststück zutrauen würde.
Ein sehr netter Service auf DVDs ist ja, daß man sich Untertitel einblenden lassen kann. Für einen Nicht-Muttersprachler ist das eine echte Hilfe, und erspart das mühsame (und ablenkende) Mitlesen im Textbuch - wobei Anis Texte eine ganze Reihe eher selten gebrauchter Vokabeln und umgangssprachlicher Wendungen enthalten, die ich auch so nicht auf Anhieb verstehe.
Weniger überzeugt bin ich von der Soundqualität. Es gibt zwei Tonspuren, eine in PCM-Stereo, eine in 5.1 Surround; die Surround-Spur hat eine derart unbestimmte Räumlichkeit, daß ich schleunigst umgeschaltet habe - die Stereo-Spur ist zwar besser, mir aber deutlich zu basslastig. Generell ist der Mix nicht wirklich sauber; das Vibraphon matscht stellenweise das Klangbild derart zu, daß man die Akkorde nicht mehr zuordnen kann - aber bei Live-Aufnahmen lassen sich solche Probleme generell schwer lösen.
Von der Bildregie hätte ich mir gewünscht, daß sie sich ein bißchen weniger an MTV&Co. orientiert hätte - es wird in nahezu jedem Takt geschnitten, möglichst noch in eine wilde Kamerafahrt hinein.
Genug gemeckert. Nachdem mich Anis letztes Album ("Red Letter Year") nicht wirklich begeistert hatte, hat mich diese DVD gewissermaßen zurückgeholt - ihre nächste CD werde ich unbesehen kaufen. Davon abgesehen wäre ich wirklich gern mal "live" dabei.
Nigel Kennedy
City of Birmingham Symphony Orchestra
Simon Rattle
Edward Elgar (1857-1934) hat sein Violinkonzert 1909 geschrieben; die Uraufführung fand ein Jahr später in der Queen's Hall in London statt, mit Fritz Kreisler als Solisten, dem das Werk auch gewidmet ist.
Wenn man Elgar und sein Werk mit all dem vergleicht, was in jener Zeit die Welt der Musik bewegte, ist man zunächst geneigt, ihn als Epigonen einzuordnen, der bei den harmonischen und formalen Mitteln eines Johannes Brahms stehen bleibt. Damit wäre er einer von vielen, der von all den Neuerungen Mahlers oder Strauss' (Salome) - ganz zu schweigen von Arnold Schönbergs erstem Tasten in Richtung Freie Atonalität - nicht das Mindeste aufnahm, geschweige denn antizipierte.
Auf den ersten Blick hat das Violinkonzert einen ganz konventionellen Aufbau: der erste Satz folgt den Regeln, die bereits in Mozarts Klavierkonzerten formuliert wurden (Sonatenhauptsatz mit zwei kontrastrierenden Themen, mit einer doppelten Exposition zunächst durch das Orchester, dann den Solisten); es folgt ein langsamer Satz, in dem der Solist zeigen kann, daß er nicht nur über virtuose Technik verfügt, sondern auch "singen" kann; zum Schluß folgt ein furioser Kehraus, der das Publikum zu begeistertem Applaus ob der gezeigten Zaubertricks auf dem Instrument hinreißen soll.
Wenn man ein wenig genauer hinsieht, finden sich jedoch eine Reihe Züge, die aus dem Schema ausbrechen. Im letzten Satz etwa bricht das übliche virtuose Feuerwerk in der Hälfte einfach ab. Es folgen fast zehn Minuten, in denen der streckenweise vom Orchester unbegleitete - "im Stich gelassene", möchte man meinen - Solist vor sich hingrübelt, das Thema aus dem langsamen Satz nochmals aufgreift, und eine fast strukturlose Einöde aus einsamen Gedanken entwirft. In der letzten Minute wird das Hauptthema nochmals kurz vom aufbrausenden Orchester hochgefahren, um mit einem völlig willkürlichem Optimismus (plötzlich wird aus h-moll noch ein Schluß in H-Dur) den vorangegangenen zauderlichen Pessimismus letztlich zu unterstreichen.
Ich rede über Musik nicht gerne in solcher Bildersprache - meistens ist das eine Ausrede, weil man nicht über die technischen Begriffe verfügt, um das zu beschreiben, was man gehört hat. Bei Elgar gibt es durchaus einen Grund, dies dennoch zu tun: die Anlage seiner Werke (und das gilt für das Violinkonzert in besonderem Maß) folgt letztlich einem dramatischen Programm. Das allein ist nichts Besonderes; Hector Berlioz hat das Verfahren erfunden, und die Neudeutschen um Franz Liszt haben knapp fünfzig Jahre später behauptet, Neuland zu betreten, als sie es benutzten. Außergewöhnlich bei Elgar - nochmals knapp fünfzig Jahre später - ist der Versuch, die klassischen Formen so zu verwenden, daß diese die dramatischen Ideen des fin de siêcle transportieren. Das ist eine außerordentlich sprechende Musik - und in dieser (nur in dieser) Hinsicht mit jener Gustav Mahlers verwandt.
Zur verlinkten Aufnahme: von Nigel Kennedy ist bekannt, daß er einen gigantischen Verkaufserfolg mit seiner Aufnahme von Vivaldis "Vier Jahreszeiten" hatte, und außerdem als "Rebell" im Klassiklager gilt, weil man ihn zuweilen auch mal bei Jazz- oder Popaufnahmen findet. Wenn man sich seine Interpretation von Elgars Konzert anhört, dürfte man in seinem Urteil einen Schritt weiter sein: das ist ein technisch unglaublich versierter Geiger, dem bei allem Virtuosentum nur eines wichtig ist: die musikalische Substanz.
Leslie Feist, Jahrgang 1976, Sängerin und Gitarristin, ist kürzlich durch den Werbespot für Apples iPod-Nano bekannt geworden („1-2-3-4”) – dabei segeln ihre CDs unter dem „Indie”-Label, und sind tatsächlich auf eine sehr spezielle Weise vom Mainstream weit entfernt.
Da ist zunächst die starke Reduktion der Arrangements, die manchmal auf eine einzelne Gitarre beschränkt sind, die mit minimalistischen Einwürfen umgeben wird – einem Xylophon etwa, das eine halbe Phrase synchron mit der Stimme geht, oder einer zweiten Gitarre, die zunächst gar nicht recht wahrnehmbar ist. Gelegentlich kommt das auch mit einer breiteren Besetzung daher – dann aber immer so, daß es gerade noch reicht, um das Genre zu erkennen, dem das Stück zugerechnet werden will. So ist „Inside Out” eine veritable Disco-Nummer mit allen benötigten Zutaten – einer durchbretternden Bassdrum auf 1 und 3, Synthi-Bläsern, die stark nach DX-7 klingen, und einem Chor ala Bonney-M im Refrain – aber eben auch keiner mehr. „Secret Heart” (einer meiner Favoriten) zitiert Reggae – und auch das nur mit jenen Stilelementen, die es unbedingt braucht. Das geht so weit, daß die erste Strophe mit Stimme, Bass und einem beim besten Willen nicht weiter reduzierbaren Schlagzeug auskommt. Dem Faß die Krone setzt „Tout Doucement” auf: das ist ein Rumba im Stil der französischen Chansons, der mit einem Klavier beginnt, das den Rumba soweit herunterfährt, daß dem Bass (1+3) gerade ein Ton auf der 2+4 entgegen steht.
Zu dieser Ökonomie der Mittel paßt die Art, in der Feist ihre Stimme einsetzt, die (ungeschult) gelegentlich in der Intonation wegrutscht, was man gerade in den (zahlreichen) leise gesungenen Passagen wahrnehmen kann[1]. Das hindert Feist aber nicht, sich an technisch durchaus anspruchsvollen Linien zu versuchen. Dieser Gegensatz zwischen unretouchierter[2] „Unperfektion” auf der einen und Virtuosentum auf der anderen Seite ist im Kontext dieser Musik außerordentlich wirkungsvoll, und unterstreicht noch deren Ökonomie der Mittel.
Wenn da nur reduziert und gespart würde, wäre das im Resultat eher langweilig. Der Witz ist, daß praktisch kein formaler Teil wörtlich wiederholt wird. Jede Strophe und jeder Refrain bieten etwas, was völlig neu ist, und meist zuvor noch nicht einmal angedeutet wurde – sei es, daß ein neues Instrument dazu kommt, oder (wie in „When I was a Young Girl”) die Solostimme erst in der zweiten Strophe vom Baß, dann endlich von Harmonien begleitet wird.
Diese Musik ist geprägt von einem Eklektizismus, der die Vorbilder nicht direkt zitiert, sie aber auch keinesfalls ironisiert: das läßt sich eher als Dekonstruktivismus beschreiben, bei dem dem Original nicht nur das Fell abgezogen wird, sondern noch die einzelnen Knochen nebeneinander gelegt werden, um diese hinterher ganz liebevoll zu einem neuen Gerippe zusammenzusetzen.
Das Krux der heutigen Popmusik ist ja, daß sie nur noch zitieren kann. Wenn sie das wörtlich tut, kommt jener Kram heraus, den man ständig im Radio hört, und bei dem man nicht mehr weiß, ob man es mit den Hits der Siebziger oder denen des neuen Jahrtausends zu tun hat. Wenn man versuchen würde, über solche Zitate mit den Mitteln der Ironie herzufallen, käme man zu gar keiner Musik – deshalb tut das auch keiner.
Feist schlägt hier einen Weg vor, bei dem zwar auch keine Neudefinition des Pop herauskommt, der aber zu Musik führt, die man zumindest so noch nicht gehört hat – und das ist gar keine so schlechte Leistung.
- [1] "Ungeschult" heiß nicht "schlecht" oder "nicht gekonnt" - jedenfalls nicht zwangsläufig, und hier ganz bestimmt nicht.
- [2] Es gibt mittlerweile nicht nur mit Melodyn oder Autotune Tools, mit denen sich im Studio noch der schlimmsten Inkontinenz in Sachen Intonation nachhelfen läßt - das hat man hier natürlich nicht nötig; im Gegenteil: man macht sich davon frei.
Ingo Metzmacher
Bamberger Symphoniker
Cornelia Kallisch, Alt
EMI 1999
Karl Amadeus Hartmann (1905-1963) ist weitgehend vergessen – wobei er nie wirklich bekannt war. Der Hauptteil seines Schaffens entstand während der Naziherrschaft in der „inneren Emigration”, in seiner Geburtsstadt München. Kaum je aufgeführt – wenn, dann nur im Ausland – steht er für den künstlerischen Widerstand schlechthin: wo andere das braune Treiben von außen kommentierten, hatte er es unmittelbar vor Augen. Seine Musik ist die einzige, die ich als dezidiert politisch durchgehen lasse; selbst Eisler und Weil begnügen sich letztlich damit, politische Statements zu illustrieren. Bei Hartmann ist die Verzweiflung über die politischen Zustände Ausgang, Struktur, und Zweck der Musik selber.
Die 1.Sinfonie trägt den Untertitel „Versuch eines Requiems”, und wird über weite Strecken von Gesang zu Texten Walt Witmanns getragen. Hartmanns Musik ist im Grunde sehr einfach strukturiert. Sie bedient sich erweiterter Tonalität, die z.T. bis in engste Cluster führt, einem breiten Apparat an Schlaginstrumenten, und an Jazz erinnernder Rhythmik. Dabei verzichtet sie auf komplexe Polyphonie und ist über weite Strecken fast homophon; gelegentlich wird das ganze Orchester wie ein Percussionsinstrument verwendet. Fünf Sätze in einer knappen halben Stunde tragen Trauer, Schmerz, und ohnmächtigen Protest, in kompromißloser Schärfe.
Metzmacher ist Verfechter der Moderne, zudem bekennender Hartmann-Fan. Sein Dirigat dürfte aus den Bambergern herausgeholt haben, was möglich war – er war hier in Hamburg bis vor drei Jahren Gerneralmusikdirektor, und ich habe oft erlebt, was er mit einem eher mittelmäßigen Orchester wie den Hamburger Philharmonikern auf die Beine stellen konnte. Leider sind die Bamberger allenfalls Drittrangig; hinzu kommt ein ebenfalls mittelmäßiges Team am Mischpult. Das Resultat ist ein nur mühsam durchhörbarer Klangbrei, den ich bei größerer polyphoner Komplexität nicht ertragen könnte. So bleibt es die einzige mir bekannte Aufnahme einer Musik, die wesentlich größere Verbreitung verdient hätte.
Wenn Adornos These zutrifft (zu der ich einen durchaus kritischen Stand vertrete), daß sich ein Streichquartett Schönbergs leichter hören läßt als eines von Beethoven, dann gilt sie für die Werke Haydns[1] erst recht. Im ersten Eindruck trifft man hier auf eine Musik, die geradezu das Klischee dessen vertritt, was man sich gemeinhin unter „Klassik” vorstellt: einfachste Strukturen, nette Melodien, darunter ein simples Gerüst aus Dreiklängen: man sieht die Musiker in ihren Barockkostümen vor sich, und riecht förmlich das Puder auf ihren weißbezopften Perücken.
Wenn man an den Werken der Spätromantik geschult versucht, sich in der Tonalität im Übergang zwischen Barock und Klassik zurechtzufinden, hat man zwangsläufig den Eindruck allergrößter Einfachheit –- und unterliegt dem nahe liegenden Kurzschluß, es mit dem „Papa Haydn” zu tun zu haben, der zeitlebens im fürstlichen Haus schrullig vor sich hin werkelte, und auf dem Höhepunkt seines Schaffens seinen Arbeitgeber auf den ausstehenden Urlaub hinwies, indem er im letzten Satz einer Sinfonie einen Musiker nach dem anderen von der Bühne schickte.
Man kann Haydn nur gegenübertreten, wenn man bereit ist, gewohntes Hören nahezu komplett aufzugeben. Wenn man dies tut, betritt man freilich einen Wundergarten mit ganz einmaligen Farben und betörenden Düften, wie es ihn in der Geschichte der Musik nur ein einziges Mal gegeben hat.
Von den 24 Sätzen im op. 20 gleicht keiner dem anderen. Jeder von ihnen hat nicht nur einen völlig eigenem Charakter: auch die Probleme, die es zu lösen gilt, sind immer neu und anders. Der komplette Ausdrucksraum, den ein Streichquartett bietet, wird ausgelotet: es gibt Passagen, die in so tiefe Lage gesetzt sind, wie dies irgend geht. Woanders sind die Streicher so hoch gesetzt, daß man vermuten könnte, Wagner habe hier für das Vorspiel zum Lohengrin geübt. Alle Instrumente bekommen thematische Arbeit, wobei das Cello manchmal höher geführt wird als die erste Geige. Die technischen Anforderungen an die Ausführenden sind z.T. enorm, insbesondere die erste Geige ist von einem Amateur definitiv nicht mehr zu bewältigen. Es gibt Fugen, die dokumentieren, wie versiert Haydn das Handwerkszeug seiner barocken Lehrer zu benutzen vermochte.
Die Menuette, Tänze und Arien mögen sich einer Zeit verdanken, in der Kompositionen für das festliche Diner, nicht jedoch den verdunkelten Konzertsaal bestellt wurden. Dennoch aber gibt es dramatische Verwicklungen, die zum Besten gehören, was die Musik aller Zeiten hier zu bieten hat – es gibt ein geradezu dialektisches Abarbeiten an extrem gegensätzlichen Charakteren. Man muß den zweiten (langsamen) Satz von op.20, Nr.2 hören (Klangbeispiel unten): hier ist Haydn dort, wohin danach Beethoven in seinem Spätwerk gelangt, und dessen Komplexität und Zerrissenheit man erst bei Mahler wiederfindet.
Außerdem kann man hier – fast schon beiläufig – miterleben, wie die Form des Sonatenhauptsatzes die Bühne der Musikgeschichte betritt (die sie – bis heute – nicht mehr verlassen hat). Im 1. Quartett Es-Dur sieht man noch, wie der erste Satz in seiner Struktur fast ein wenig klappert im Bemühen, die Vergangenheit der Divertimenti mit ihrer Folge von Tanzsätzen zu verlassen (wobei alle sechs Quartette das „Divertimento” noch im Titel tragen). Da findet sich ein klarer Plan im Verhältnis der Tonarten: im ersten Teil wird aus Es- B-Dur; die Reprise hingegen verbleibt in Es-Dur, und nimmt die Spannung der Exposition zurück. Etwas wie ein Seitenthema sucht man hingegen vergeblich: man findet weitgehend Variationen des Hauptthemas, so daß dem harmonischen Kontrast keine Entsprechung im Kontrast zweier Themen gegenüber steht. – In den folgenden Quartetten dieser Reihe findet man nach und nach immer mehr Spuren eines „echten” zweiten Themas – am deutlichsten vielleicht in 3. und 5. Quartett, weil sie in Molltonarten kommen, und das Auftauchen der Durparallele im Seitensatz fast schon notwendig neues melodisches Material erfordert.
- [1] Das Wörterbuch vom Firefox kennt den Namen nicht, und schlägt als Ersatz vor: „Handy” – ein hübsches Beispiel für das Wirken des Algorithmus, der vermeidliche Dreher entdeckt.
Joseph Haydn
The Complete String Quartets
The Angeles String Quartet
Philips Classics
Der Schuber ist teuer (~€150 für immerhin 21 CDs), aber lohnend.
Das Angelis-Quartett war mir vorher unbekannt, kann sich aber durchaus mit weit berühmteren Streichquartetten messen. Die Intonation – selbst bei Spezialisten wie dem Julliard–Quartett zuweilen eine heikle und brüchige Angelegenheit – ist stets hervorragend. Rhythmische Akkuratesse mit sehr sparsamer Agogik läßt auch die langsamen Sätze nicht in gesuchter „Bedeutung” und „Tiefe” ersaufen. Das Zusammenspiel ist tadellos und läßt vermuten, daß ausgiebig geprobt wurde [1]. Nicht zuletzt ist auch die Aufnahmequalität hervorragend – wobei ich allenfalls über den etwas mächtigen (Kirchen)Hall des Aufnahmeortes mäkeln kann.
Ein Detail zu der Interpretation fällt auf, das zu grundsätzlichen Überlegungen anregt: obwohl in den Noten ausdrücklich verlangt, verweigert das Angelis-Quartett im jeweils ersten Satz der Quartette die Wiederholungen von Durchführung&Reprise.
Normalerweise würde ich angesichts eines derart eklatanten Verstoßes gegen den Notentext ganz schlechte Zensuren verteilen; hier jedoch geschieht er aus gutem Grund. Anders als Haydn wissen die Interpreten nämlich, worauf der Sonatenhauptsatz hinausläuft: auf einen Spannungsbogen, der mit der Reprise des Seitenthemas in der Gundtonart unwiderruflich zu Ende ist, und der sich eben nicht wiederholen läßt.
Wenn Haydn im zweiten Teil Wiederholungszeichen setzt, greift er auf alte Muster zurück, und zeigt, daß er mit etwas experimentiert, dessen Implikationen er selber noch nicht vollständig versteht – es ist kein Zufall, daß alle sechs Werke mit „Divertimento” überschrieben sind.
Die Interpretation setzt nicht dort ein, wo die Subjektivität eines Interpreten eine Partitur „aufbläht” (und genau das passiert beim „Spielen mit Gefühl”), sondern da, wo man die Partitur ihre eigenen Bahne verfolgen und ihre eigenen Ziele ansteuern läßt. Die Bewegung, die von der reinen Reproduktion eines Musikstücks fortführt, kommt also nicht von außen, von der Subjektivität des Interpreten, sondern ist eine Bewegung, die potentiell in jeder Partitur angelegt ist und darauf wartet, von einem Interpreten freigesetzt zu werden. Das Ereignis bei einer echtem, angemessenen Interpretation besteht nicht darin, daß der Interpret seine Gefühle ausdrückt, sondern daß sich die Musik postum neu erfindet.
(Alessandro Baricco – Hegels Seele oder die Kühe von Wisconsin (Nachdenken über Musik), München 1999)
- [1] Eigentlich ist es ja unglaublich, daß man das ausdrücklich vermerken muß.
Perfume
Das Pattern zu Beginn ist im 5/8tel-Takt, oder? Irgendwo ist da ein Achtel zuviel, oder sind das eher 4-1/2 Achtel? – ist es nicht; doch ein 2/4-Takt in einer irritierenden Betonung der Noten auf dem letzten Achtel in der Phrase? – man kann den Puls jedenfalls nicht (allenfalls stellenweise) mitklopfen.
Wobei: das ist total egal. Ich erwähne das nur, um dem Verdacht zu entkräften, dies sei ein belangloses Getändel (wenn man sich denn der Magie des Songs überhaupt entziehen kann).
It's Too Late
Der Song im Video oben ist rhythmisch eher einfach gestrickt, wobei die Klangfarben des Orchesters außerordentlich kunstvoll gemischt sind – etwas völlig anderes als „Perfume”, und trotzdem, beim Hören, irgendwie und -wo mit dessen Konzeption verwandt.
Ich bekomme das, analytisch, nicht recht auf den Punkt (was, wie oben schon erwähnt, sowieso total egal ist).
Thea Hjelmeland spielt morgen Abend im Nachtasyl – ich bin werde dort sein; sehr gespannt.
Nachtrag: Das Konzert liegt hinter mir, und ich habe gerade die CD auf dem Kopfhörer, die ich noch im "Nachtasyl" kaufte.
Das Album („Solar Plexus” - Amazon-Link) ist richtig spannend, und spielt in einer ganz eigenen Liga (die verlinkten Videos oben geben einen recht guten ersten Eindruck, in welche Richtung das geht). Wenn man es nur einen Tag nach dem Konzert hört – wenn man die Songs noch in ihrer „Live”-Inkarnation in Erinnerung hat – wirkt es seltsam enttäuschend. Hjelmeland ist auf der Bühne derart präsent, daß (im unmittelbaren Vergleich mit einem reproduzierbaren Kunstwerk, wie der CD) das gar nicht anders sein kann.
Selbst nur der Versuch zu beschreiben, was mich da gestern geradezu umgehauen hat, macht wenig Sinn. Man muß Hjelmeland live erleben, um meine Sprachlosigkeit nachzuvollziehen (und wohl auch das Glück haben, Teil eines höchst konzentriert zuhörenden Publikums zu sein, wie das im Nachtasyl der Fall war).
Vielleicht habe ich doch zumindest eine Annäherung:
Der letzte Song auf dem Album wie beim Konzert ist „Cold Hands“, eine Totenklage („Cold hands, watch me pray / God disappears as you fade“). Die musikalischen Mittel legen nicht unbedingt nahe, wovon der Text handelt; allenfalls die nun bis ins Letzte zugespitzte Sparsamkeit der Mittel (genau nur ein Riff von der Gitarre; eine ständig wiederholte Phrase im Gesang) gibt einen Hinweis.
Bei der Studioaufnahme ist der Kontrast (zum Rest der Songs) fast glattgebügelt: das Tempo ist gleichförmig und wie am Marschieren; die Stimme wird mit einem Effekt gedoppelt und kommt gewissermaßen überlaut von rechts und links aus den Lautsprechern.
Anders Live. Jene Intensität – von Rhythmik, Stimme –, die es mir vorher selbst in den leisesten Passagen fast unmöglich gemacht hatte, auf meinem Platz still sitzen zu bleiben, wirkt wie weggefegt. Die Gitarre wird zum Leierkasten, und die Stimme kommt aus der mittleren Lage ihres tiefen Registers nicht heraus – man kann kaum anders, als auf den Text zu achten. Dazu braucht es keine besonderen Ausdrucksmittel im Gesang, und keiner Schauspielerei. Es wird unvermittelt klar, worum es hier geht.
Der Name Korngold ist selbst unter den Hörern von sog. "Klassik"[1] nicht weiter bekannt. Das war im Wien der 20er Jahre völlig anders, und Hollywood beruft sich auf sein Erbe bis heute.
Erich Wolfgang wurde 1897 als Sohn des gefürchteten und einflußreichen Musikkritikers Julius Korngold geboren, und galt als Wunderkind. Bereits als Dreizehnjähriger erlebte er die Uraufführung einer eigenen Komposition - und zwar gleich an der Wiener Hofoper und unter ihrem ersten Dirigenten, Frank Schalk. Die Uraufführung seiner Oper "Die tote Stadt" 1920 machte ihn zu einer Berühmtheit weltweit (wobei jeder, der es als Musiker im Wien jener Zeit zu etwas gebracht hatte, eh schon weltberühmt war).
Beim Anschluß Österreichs 1938 emigrierte Korngold in die USA, genauer: nach Hollywood. Im Unterschied zu anderen Emigranten wurde er mit offenen Armen empfangen: bereits 1934 hatte er Max Reinhards Verfilmung des Sommernachts-Traums musikalisch begleitet. Warner Bros. bot ihm einen Vertrag, der unter heutigen Verhältnissen unglaublich klingt: er sollte gerade zwei Filme pro Jahr vertonen, unter vollem Beibehalt aller Rechte an den Kompositionen zur späteren anderweitigen Verwendung.[2]
Korngold gilt als Epigone und Eklektiker. Wenn man Adornos Idee vom Fortschritt des künstlerischen Materials im Gepäck hat, kann man ihn sicherlich so einordnen - und gleichzeitig als unbedeutend und nicht hörenswert beiseite schieben. In meinen Augen wäre das töricht.
Die viersätzige, erst 1952 vollendete "Symphony in F Sharp" beruht auf Themen aus Filmmusiken, ist aber ein in sich geschlossenes Gebilde, das auf klassische Formen zurückgreift und durchaus als Symphonie (mit allen Erweiterungen und Umdeutungen im Sinne Mahlers) gehört werden kann.
Korngold wurde zum bekennenden Bewunderer Bartoks - und das merkt man diesem Werk an: es gibt schärfste dissonante Reibungen, die aber immer tonal zuordbar bleiben. Entweder ist das eine "Verdickung" einer einstimmigen Linie - oder ein dissonierender Akkord wird, in bester Tradition Wagners, nach und nach als Vorhalt der dissonierenden Töne "erklärt". Hinzu kommt die beinah exzessive Verwendung von Schlagwerk und Perkussion in ungerader Metrik.
Der langsame (dritte) Satz ist ein echtes Hilite jener mit an wunderschönen langsamen Sätzen reich gesegneten Spätromantik: man muß das gehört haben, wenn man auch sonst, als Mahler-Affiner, nicht schlafen kann, nachdem man z.B. das Es-Dur-Adagio der Sechsten gehört hat. - Der letzte Satz gibt den Bruckner und zitiert alle drei Sätze zuvor - und zwar nicht ungeschickt-gewollt, sondern auf höchstem handwerklichem Niveau..
Epigonal? Klar. Aber wen kümmerts - und über die Wirkung Korngolds auf uns Heutige habe ich noch kein Wort verloren (als Teaser: die Bilder aus Berlin vom Jahreswechsel auf 08 wurden auf dem ZDF vom Starwars-Soundtrack begleitet -und keiner hat das gehört (gehört im Sinne von: zugeordnet), geschweige kommentiert).
- [1] Beim Wort "Klassik" dreht sich mir der Magen um - ich muß dringend einen eigen Eintrag zum Thema schreiben.
- [2] Zur Filmmusik Korngolds später mehr.
Als Bruno Walter in jenem Juli [1895] am Steinbacher Schiffssteg an Land ging und auf die Klippen des Höllengebirges starrte, sagte Mahler zu ihm, er brauche sich das gar nicht anzusehen, denn »das habe ich schon alles wegkomponiert«.
(Jonathan Carr: Gustav Mahler, München 1999, S.108)
Diese Aussage bezieht sich sicherlich auf den ersten der sechs Sätze, der in seiner wilden Zerrissenheit und Zerklüftung wie von selbst die Assoziation mit einem Hochgebirge aufkommen läßt – mit einer Natur, die dem Menschen unbeherrscht und feindlich gegenüber tritt. In der 3.Sinfonie geht es aber letztlich um alle Aspekte von Natur; die (noch vor der Drucklegung zurückgezogenen) programmatischen Überschriften der sechs Sätze lauten: 1) Pan erwacht: der Sommer marschiert ein, 2) Was mir die Blumen auf der Wiese erzählen, 3) Was mir die Tiere im Wald erzählen, 4) Was mir der Mensch erzählt, 5) Was mir die Engel erzählen, 6) Was mir die Liebe erzählt.
Der erste Satz ist nicht nur mit seinen ständig wechselnden Stimmungen – Dreiklangsmotive in den Flöten neben schärfsten Dissonanzen des gesamten Orchesters, Fanfaren von sämtlichen acht(!) Hörnern und feinstes Gespinn aus im Pianissimo tremolierenden Streichern, ein ständig präsentes Leitmotiv, das mit einem Sekund-Vorhalt zum Grundton endet, der aber nie erscheint, usf. – sondern auch durch seine schiere Länge von knapp 900 Takten und einer Dauer von mehr als einer halben Stunde letztlich der Dreh- und Angelpunkt des gesamten Werks.
Der zweite Satz war im Wien des »Fin de siècle« ein echter Schlager, und wurde immer wieder herausgelöst aus dem Kontext von Nikisch u.a. aufgeführt – was kein Wunder ist, steht hier doch eine wunderhübsche kleine Melodie im Zentrum, die den Satz in ein »Lied ohne Worte« verwandelt. Mahler hat das mit gemischten Gefühlen gesehen – so sehr er gehört werden wollte, so sehr mißfiel es ihm gleichzeitig, daß man ihn „dem Publikum als `sinnigen´, duftigen `Sänger der Natur´ vorstellt” (Mahler in einem Brief; Carr, a.a.O).
Der dritte Satz ist ein Scherzo, das bedrohlich-verhuscht eine ganz andere, weit düstere Welt beschwört. Das Trio wird ersetzt durch einen langen, kaum enden wollenden Gesang von einem Posthorn, das aus „weiter Ferne” (gewöhnlich dadurch realisiert, daß man das Instrument hinter der Bühne spielen läßt) über ein paar wenigen Dur-Akkorden der Streicher erklingt.
Der vierte Satz ist der Gesang einer Alt-Stimme über einen Text von Nietzsche aus »Also sprach Zarathustra«: »O Mensch! Gib acht! Was spricht die tiefe Mitternacht?«. Das ist ein ganz langsamer Gesang über viel tiefes Blech – das Eingangsmotiv war übrigens schon im ersten Satz aufgetaucht.
Danach kommt ein ganz kurzer, beschwingter (in der Partitur steht: „Lustig im Tempo und keck im Ausdruck”) und fast schon banaler Satz, in dem ein Knabenchor mit einem ständigen »Bimm-Bamm« Glocken imitiert, über die ein Frauenchor einen Wunderhorn-Text legt: »Es sungen drei Engel einen süssen Gesang«. Das ist sehr typisch für Mahlers Musik: wenn man vor Andacht und Bedeutung schon so tief in das Polster des Sessels im Konzertsaal gedrückt wird, daß man kaum noch Luft bekommt, fährt der Meister mit einer komplett unernsten Geste dazwischen – als wenn er auf den Hörer grinsend mit dem Finger zeigt und sagt: erwischt.
Das Finale schließlich ist ein für Mahler so typisches Adagio, das in allergrößter Ruhe einen fulminanten Bogen vom im pianissimo von den Streichern vorgetragenen Thema bis zu einem in der kompletten Besetzung bei größter Lautstärke spielenden Orchester schlägt: »Was die Liebe erzählt«.
Von den Symphonien Mahlers ist die 6. sein konventionellstes Werk (sofern man diesen Ausdruck im Zusammenhang sinnvoll verwenden kann), mit einem 1. Satz, der mit einem Sonaten-Hauptsatz daherkommt, und dessen Exposition sogar wiederholt; einem Scherzo mit deutlich abgesetzten Trio, einem langsamen Satz, dem ein singbares Hauptthema eine klar erkennbare Struktur gibt - und einem Finale, das sich jeder Zuordnung entzieht. Die Haupttonart ist A-moll, und findet sich in immerhin drei von vier Sätzen (das Es-Dur des Adagios wird in den ersten Takten des Finales in die Haupttonart zurückmoduliert - weswegen es keine gute Idee ist, die mittleren Sätze auszutauschen, wie das Mahler eigentlich verlangte).
Dabei kann man kaum behaupten, daß das leichte Kost ist. Beim ersten Hören nimmt man eine Unzahl einzelner Ereignisse wahr und wird kaum eine Struktur erkennen - und da das komplette Werk neunzig Minuten dauert, kann es schnell passieren, daß man sich entnervt abwendet.
Diese Musik ist wie ein riesiges, verwunschenes Schloß, in dessen verwinkelten Fluren und Gemächern man sich anfangs unweigerlich verirrt. Nach und nach gewinnt man einen Plan - und hat noch Wochen später längst nicht jedes der zahllosen kostbaren Details gesehen, die Wände und Flure schmücken.
Trotz dieser Schwierigkeiten würde ich die 6. empfehlen, wenn jemand einen Einstieg sucht: die anderen Symphonien setzen an Komplexität eher noch einen drauf.
Es gibt zahllose Einspielungen, und die fünf in meinem CD-Regal sind nur die Spitze des Eisbergs. Am gelungensten finde ich momentan Benjamin Zanders Dirigat des Philharmonia Orchester (und die habe ich auch gerade gehört):
Die c-moll-Messe stellt ohne Frage einen Höhepunkt in Mozarts Schaffen dar - umso wunderlicher wirkt es, über welche Brüche und Widersprüche man hier stolpert.
Zunächst wird man jemanden, der von Mozart nur die "Nachtmusik" und vergleichbare unterhaltsame Spielereien kennt, schwer davon überzeugen, daß etwa das "Gratia" - das mit Chor und großem Orchester besetzt ist und mit einer Dissonanz schon startet, bevor es in chromatischen Vorhalten fortschreitet und nicht zur Ruhe kommt - vom selben Komponisten stammt. Auch die Arien[1] sind alles andere als typisch für den gewohnten Mozartstil: es gibt keine Melodie, die von einigen Akkorden begleitet wird, sondern hier ist alles Melodie, selbst der Baß, selbst die zweite oder dritte Stimme in den Mittellagen. Anhand solcher Merkmale würde ich zunächst auf Barock tippen - nicht auf Johann Sebastian Bach (dafür gibt es einige Ecken und Kanten zuviel, wie auch einige harmonische Bewegungen fast zu vorhersehbar sind), aber vielleicht auf einen der "kleinen" (deshalb nicht "geringen") Meister jener Epoche. Doch auch für eine solche Zuordnung gibt es viel zu viele merkwürdige Brüche, erst zwischen den einzelnen Abschnitten, dann aber auch innerhalb der Sätze selbst.
Am auffälligsten empfinde ich den Kontrast all der polyphon ausgestalteten Sätze zum "Credo", das in seinen monophonen(!) Passagen schon eine fast polternde Heiterkeit verbreitet - wobei gut: die gibt es z.B. in einigen Neujahrkantaten Bachs ebenso.
Das "Kyrie" zerfällt in zwei deutlich hörbar kontrastierende Teile: den überaus düsteren Beginn in c-moll, der Bach fast zu zitieren scheint, und die Sopran-Arie im Mittelteil in Es-Dur. Der Wechsel von Moll nach Dur ist natürlich nicht ungewöhnlich, und jener in die parallele Durtonart erst recht nicht; was jedoch verwirrt, ist ein drastischer Stilbruch. Zunächst war die Harmonik von chromatischen Baßbewegungen geprägt, und der Statik der Akkordbrechungen in den Oberstimmen der Geigen wird ein komplexer polyphoner Chorsatz entgegen gestellt - so kennt man das aus dem Eingang vieler Passionen und Messen im Barock. Plötzlich löst sich jedoch eine Solostimme (der Sopran), die Harmonik wird zu simplen Dreiklang-Kandenzen, und es gibt keine Nebenstimmen mehr - so kennt man das aus der "Zauberflöte".
Es ist mehr als bewundernswert, wie es Mozart gelingt, dieses Auseinanderfallen in der Folge geradezu ungeschehen zu machen: er verbindet das Sopransolo mit der Reprise des Chorsatzes in einer bruchlosen Logik, die beim ersten Hören gar nicht auffällt, und beim bewußten Mitlesen der Partitur ungläubiges Staunen hervorruft.
Die Messe entstand im Herbst und Winter 1782/83, und zwar nicht zielgerichtet für einen bestimmten Anlaß, wie viele andere Werke Mozarts, sondern schubweise, u.a. während der Auseinandersetzung des Sechsundzwanzigjährigen mit der barocken Tradition. Aus dem Vorwort zur Bärenreiter-Ausgabe ergibt sich ein Labyrinth in der Entstehungsgeschichte, ein Puzzle aus Skizzen und halbfertigen Partiturteilen, das irgendwie - fast zufällig - zusammengefügt schließlich in Salzburg, anläßlich der Vorstellung seiner Frau Konstanze beim Vater, am 26.Oktober 1783 uraufgeführt wird.
Es ist keine vollständige Partitur des gesamten Werks überliefert, sondern wieder nur ein Puzzle aus einer Separatpartitur für die Bläser (damals gab es Notenpapier nur mit maximal zwölf Systemen, so daß Mozart Streicher und Chor sowie die Bläser auf unterschiedlichen Blättern notierte[1]), einem später zufällig wieder aufgefundenen Paket Einzelstimmen für einige Abschnitte, usw. usf. Darüber hinaus gab und gibt es unterschiedliche Versuche, den Ablauf einer vollständigen Messe zu rekonstruieren, etwa indem man Abschnitte aus anderen, früheren Messen Mozarts einfügt, oder die Fragmente von anderen Komponisten ergänzen läßt.
Man steht hier einem Werk gegenüber, das letztlich in alle Winde verzettelt ist, und zwar in jeder Hinsicht: in der Entstehung; im Zwiespalt aus Geniestreich und Handwerksübung; und in der Geschichte seiner Überlieferung. Es ist schon verrückt. daß man sich trotzdem hinsetzen und diese Musik einfach hören kann.
Oelze, Larmore, Weir, Kooy
Collegium Vocale, La Chapelle Royale
Orchestre des Champs Elysées
Philippe Herreweghe
Die Aufnahme ist - einmal mehr - HIP, d.h. "historisch informierte" Aufführungspraxis mit relativ kleiner Besetzung, schlanken Stimmen, und Streichern, die auf Vibrato verzichten und statt dessen reichlichst Gebrauch von den Leersaiten machen. Ich hatte heute kurz bei einer Aufnahme von Harnoncourt vorbeigehört (der ja selber mehr oder weniger "zur Szene" gehört), und nach ein paar Geräuschproben die CD zurück ins Regal gestellt: die Besetzung mit einem romantischen Riesenorchester und großem Chor klingt für solche Musik in meinen Ohren mittlerweile einfach bloß falsch.
Rodney Gilfry (Don Giovanni)
Lásló Polgár (Leporello)
Isabel Rey (Donna Anna)
Roberto Saccá (Don Ottavio)
Cecilia Bartoli (Donna Elvira)
Liliana Nikitenau (Zerlina)
Oliver Widmer (Masetto)
Matti Salminen (Commandantore)
Chor und Orchester des Opernhaus Zürich.
Nikolaus Harnoncourt
Inszenierung: Jürgen Flimm
Arthaus (DVD)
Es gibt zwei Werke, die mir beigebracht haben, warum man Mozart im Lauf der letzten Jahrhunderte so bewundert hat: die C-moll Messe K.427 - und Don Giovanni.
Beiden Werken ist gemeinsam, daß Mozart in ihnen aus einem riesigen Repertoire musikalischer Techniken schöpft: Arien zwischen Buffo und Seria, Rezitativo und Accompagnata, Fugiertes mit allen im Barock entwickelten Kunstgriffen und Techniken, Instrumentationskunst, die man verschiedentlich erst bei Mahler vermuten würde (die in der Bühne versteckten Blechbläser in der Friedhofszene) usw. Man erlebt hier keinesfalls ein geniales Kind, das naiv und unverbildet reizende Werke aus dem Ärmel schüttelt, keinen gottgeküßten und halbverrückten "Amadé", als der Mozart z.B. in Milos Formans Film erscheint. Vielmehr tritt uns ein erwachsenes Genie gegenüber, das den Stand des Handwerks reflektiert und verinnerlicht hat. - Es wird hier sehr schwer, Mozarts "Stil" zu bestimmen: er kann alles, und er verwendet es auch. Wenn man jemanden, der diese Werke nicht kennt, nach dem Komponisten fragte, bekäme man sicherlich nicht Mozart als ersten Tip.
Jürgen Flimms Inszenierung ist auf eine wohltuende Weise "konventionell": Ort und Zeit werden nicht verändert, die Kostüme verweisen auf das 18.Jh. Einzig das Bühnenbild abstrahiert, verdoppelt nicht, sondern bietet Möglichkeiten, die Personen im Raum zu ordnen. Im Zentrum der Aufmerksamkeit der Regie stehen auch eben die Personen: sie sind stets in Bewegung (auch jene, die gerade nicht zu singen haben), die Handlung steht in logischer Beziehung zum Text, das "Timing" stimmt in einem Maße, daß ich das Gefühl hatte, die Darsteller würden improvisieren. Ein Beispiel, das für viele Regieeinfälle stehen soll: nachdem es Don Giovanni gelungen ist, die Hochzeitsgesellschaft zu zerstreuen und endlich allein ist mit Zerlina, gibt es vor dem Rezitativ, in dem er Zerlina zu verführen sucht (und nur durch das Erscheinen Donna Elviras scheitert), einen Moment des Schweigens: das Paar legt gemeinsam ein großes Tischtuch zusammen, sieht sich in die Augen, kommt sich Schritt für Schritt immer näher: in dem Moment, in dem es sich unmittelbar gegenübersteht, setzt die Musik ein, wobei der Zuschauer da schon weiß, daß es um die Frau geschehen ist...
Die Sänger stehen über jedem Zweifel (einzig Roberto Saccás Tenor klingt m.E. etwas überanstrengt) - wobei auch deren schauspielerische Qualitäten überraschend gut sind. Rodney Gilfry - groß, schlank, eine äußerst gutaussehende Mischung aus Mick Jagger und Matt Damon - ist nicht nur physiognomisch eine überaus überzeugendende Verkörperung des besessenden Liebhabers, sondern zudem auch im Close-Up der Kamera in jedem mimischen Detail glaubwürdig. Cecilia Bartoli müßte man eigentlich nicht besonders erwähnen - sie ist berühmt genug - aber ihre Donna Elvira hat mich wirklich vom Stuhl gerissen: allein ihre Rachearie im ersten Akt rechtfertigt den Preis für den Kauf der DVD allemal.
The Amsterdam Baroque Orchestra
Erato, 1996
Bis vor wenigen Jahren lag es in weiter Ferne, daß ich mich jemals für Mozarts g-moll-Sinfonie interessieren könnte. Das war für mich Kaufhausmusik, im Zweifelsfall mit Schlagzeug unterlegt, eine ewige Wiederholung des "dihadaa-dihadaa" des Hauptthemas. Aber diese Wahrnehmung ist natürlich völliger Unsinn - wobei man für diese Erkenntniss scheinbar ein gewisses Alter erreichen muß (ein Zwanzigjähriger, der sich für Mozart begeistert, wäre mir wohl eher verdächtig).
Am ersten Satz der Sinfonie beeindruckt mich auch weniger das Nudelthema (dafür kann Mozart nichts, er nudelt ja nicht im Mindesten, das tut erst die Rezeptionsgeschichte), sondern die konsequente Verwirklichung des Sonatenhauptsatzes. Das ist in Moll gar nicht so einfach: das Seitenthema ist in Bb-Dur, und soll in der Reprise in der Haupttonart, in G-Moll wiederholt werden. Bei den chromatisch geführten Modulationen ist es schon ein veritabler Zaubertrick, daß das gelingt.
Der zweite Satz ist in meinen Augen der Höhepunkt: was Mozart hier an Vorhalts-Modulationen vorführt, hält man kaum für möglich, wenn man sich den historischen Kontext vor Augen hält, in dem das Werk entstand. Ich müßte auf technische Details - will ich nicht. (Der dritte Satz ist ein fast barock anmutendes Scherzo: polyphone Stimmführung, 6/8-Takt mit - well: "skurrilen" rhythmischen Überlagerungen. Schließlich ein Rondo, mit einem Schwerpunkt auf thematischer Arbeit).
Koopmans Interpretation ist HIP - das steht für "historisch informierte (Aufführungs-)Praxis" und bedeutet die von mir sehr geschätzte Reduktion der Mittel: 11 Violinen, 3 Violen, zweimal Violoncello wie Baß: über diesen schmalen Streicherapparat fallen die Blasinstrumente mit großer Vehemenz her, wenn sie eingesetzt werden. Es wird dann richtig laut, obwohl man es lediglich mit (jeweils einfach(!) besetzter) Flöte, Klarinette, Horn, Trompete und Fagott zu tun hat. Flotte Tempi, sehr deutlich gesetzte Akzente wie Kontraste in der Dynamik - da setzt sich selbst ein völlig zu Tode geliebtes und gedrücktes Teil der klassischen Musik wieder aufrecht auf, hebt den Zeigefinger, und sagt: hört hin, hört einfach bloß hin.
Ich hatte die CD gerade - ohne vorab angelesene Informationen und ohne die leiseste Ahnung, was mich erwartet [1] - in den Player gelegt und versucht, der Musik so unvoreingenommen zu folgen, wie das irgend geht. - Zunächst: mit Pop hat das nichts mehr zu tun, und mir fällt kein Vergleich ein, mit dem man wenigstens einen Hinweis darauf geben könnte, wovor man hier steht.
Im ersten Moment war ich regelrecht erschrocken über Joanna Newsoms Stimme; das klingt in derart hohem Maß nach einem kleinen Mädchen, daß ich einen Moment vermutet hatte, daß man da mit einem Vocoder gearbeitet hat. Das hat man zwar nicht getan; es hält sich aber die ganze Zeit der Eindruck, es mit etwas Artifiziellem, äußerst Zerbrechlichen zu tun zu haben.

Das Hauptinstrument, von dem alle Songs getragen werden, ist die Harfe - und zwar, und das wird auch beim ersten Hinhören deutlich, gespielt von einem Virtuosen (Joanna Newsom herself, wie ich mittlerweile weiß), der ganz eigene Wege erkundet und hier Sachen macht, die ich so noch nicht gehört habe. Gelegentlich liefert die Harfe ostinate, an den Minimalismus eines Philip Glass erinnerende Begleitfiguren; anderswo kommen komplizierte rhythmische Überlagerungen, in denen der Puls zu verschwinden scheint. Neben den Ostinati in nur einer Tonart gibt es wilde harmonische Bewegungen, die aber immer mit diatonischem Material auskommen, d.h., ganz weitgehend mit reinen Dur- oder Mollakkorden. Das ergibt sich aus der Natur des Instruments, mit dem man bekanntlich chromatische Läufe nur mit Hilfe der Pedale spielen kann (pro Oktave gibt es nicht zwölf, sondern sieben Saiten).
Gleich zu Beginn begegnet man den Orchesterarrangements, die für vier der fünf Stücke eine große Bedeutung haben. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine "Begleitung", die hinter oder unter den Harmonien liegt und nur einige Farben beisteuert; das Orchester ist neben Harfe und Stimme völlig gleichberechtigter und eigenständiger dritter Protagonist. Ab und an geht das so weit, daß es in wilden Dissonanzen dazwischen funkt; meistens fügt es sich aber in den harmonischen Rahmen, wenn auch immer mit Einwürfen, die auf ihrer thematischen Eigenständigkeit beharren.
Ich sagte bereits, daß die CD gerade fünf Stücke enthält; man findet eine großflächige Struktur, die den Fluß einer ununterbrochenen Erzählung hat. Es gibt keinen Rahmen aus Strophe und Refrain; auch formale Teile, die klar als Wiederholung erkennbar wären, fehlen fast völlig. Es gibt keine Klammern, die einzelne Teile voneinander abgrenzen, sondern ein ständiges Fortschreiten ohne Punkt und Komma. Dem entspricht im übrigen der Text - ich hatte beim ersten Hören gar nicht erst den Versuch gemacht, die Worte zu verstehen, und beim Lesen des Textes dann gesehen, daß das gar nicht geht; er ist in einer Art Phantasiesprache verfaßt, die wunderschön klingt, ohne klar umrissenen Sinn.
Ich kann ja leider nicht anders, sondern mußte sofort überlegen, wie das gemacht sein könnte. Von Stück zu Stück war ich immer mehr davon überzeugt, daß man mit Samplern gearbeitet hat - die Strukturen sind derart chaotisch und zerfasert, daß der Verdacht nahe liegt, da habe man mehr oder weniger improvisierte Hand angelegt, und nach und nach Schicht für Schicht übereinander getan. Hat man aber nicht: das ist tatsächlich ein großes Orchester, das man zwar in einem zweiten Durchgang über die vorher eingespielten Takes von Harfe und Stimme aufgenommen hat, das aber komplett vorher so geplant und notiert gewesen sein muß (man kann mit Samplern im Studio improvisieren, kaum aber mit mehr als dreißig Leuten im Orchester).
Für ein Resumé ist es zu früh, wobei ich aber schon jetzt festhalten kann, daß sich diese Aufnahme nicht im ersten Anlauf erschließt. Das braucht häufiges Wiederhören - und, auch das ist jetzt schon klar, dazu gibt es allen Anlaß.
(Foto: Wikipedia)
- [1] Das ist nicht ganz wahr - ich hatte kurz bei lastfm.de reingehört. Ansonsten habe ich mich einfach darauf verlassen, daß mein persönlicher Tipgeber auch hier wieder ins Schwarze trifft.
Ich bin - wie so oft in solchen Dingen - durch Zufall über Carl Nielsen (1865 - 1931) gestolpert, die CD-Box mit seinen sechs Sinfonien lag auf dem Grabbeltisch bei Saturn. Nach kurzem Reinhören habe ich sie gekauft, in eines meiner Regale gestellt - und vergessen. So also geht das, dachte ich, als ich die Aufnahmen zufällig wiederfand, so geht das, wenn Musik aus dem Gedächtnis der Welt verschwindet.
Die 1.Sinfonie habe ich vor ein paar Tagen gehört, und war freundlich überrascht: das ist (natürlich) ganz viel Wagner-Harmonik, aber auch Eigenes, Moll-Terzverwandschaften etwa, oder ein merkwürdiges Vexierspiel von Tonarten zwischen Dur und Moll (das klingt gelegentlich fast ein wenig nach Bluesterz - obwohl das natürlich eine abwegige Assoziation ist). Dazu kommt ein Wille zur Form, der mich an Brahms erinnert - was gleichzeitig nicht recht passen will: da scheint immer ein Drang zum Erzählen durch, die Musik furchtelt mit den Händen und schneidet Grimassen, fast wie beim fünf Jahre älteren Mahler (den Nielsen, der das Werk als Fünfundzwanzigjähriger schrieb, noch nicht kennen konnte).
Die Aufnahme von Nielsens Fünfter lief gerade eben in meinem Wohnzimmer. Sie gilt (laut dem nicht sonderlich aussagekräftigen Booklet) als sein Meisterwerk, was ich nicht recht nachvollziehen kann. Die ewigen Ostinati (im ersten Satz) und die in Dur-Seeligkeit monierten harten Dissonanzen erinnern mich an Schostakowitsch, und sie erinnern mich an dessen Scheitern beim Versuch, die Kritik an den gesellschaftlichen Verhältnissen durch Montage in die Musik hineinzuzwingen.
Ich muß zugegeben, daß ich irgendwann gelangweilt abgeschaltet habe (innerlich, die Aufnahme lief bis zu Ende), weil ich dieses Marschieren und Glück-im-Unglück-Gesuche einfach satt bin. Wahrscheinlich meint Nielsen aber etwas ganz anderes, und ich habe meine Schubladen allzuweit geöffnet, um das jetzt vernünftig beurteilen zu können.
(Diese Form der Langeweile ist übrigens eine weitere Möglichkeit, Dinge ins Vergessen zu befördern. Ich muß mich in acht nehmen)
Alexander Gorkow war 2012 dabei, als Rammstein durch Amerika tourte. Sein Text (veröffentlicht im SZ-Magazin) markiert mE. einen einsamen Höhepunkt in der Kritik von Popmusik. Gorkow ist offenkundig Fan; er bekommt das Kunststück fertig, daß man seinem Text nur deshalb folgt, weil der so gut geschrieben ist – um sich hinterher selber als Fan des Objekts seiner Berichterstattung wiederzufinden.
Die Texte von Rammstein sind, wenn man sie bloß liest, manchmal geradezu betörende Lyrik (Gorkow zitiert einige Beispiele).
Wenn ich hingegen Rammsteins Fans zu Kenntnis nehme (zB. in den Kommentaren zu Rammstein-Videos auf YouTube), möchte ich nur noch den Stecker ziehen. Man findet hier regelmäßig Lobeshymnen jener, die Rammstein richtig gut finden, weil die so typisch deutsch erscheinen – strammer Schritt und rollendes R, wie ein Geschenk zum Geburtstag von Adolf Hitler.
Das ist natürlich Quatsch; schlimmer als nur ein Mißverständnis. Trotzdem muß man sich einem Experiment aussetzen, um meinen Zugang zu dieser – Musik, hätte ich fast gesagt – eigenartigen Synthese aus Krach und inszenierten Bildern zu teilen.
Das Video unten funktioniert wohl nur, wenn man es auf einem großen Monitor in HD-Res anschaut, und die Lautsprecher möglichst aufdreht.
Dabei ist der Text ein Kinderlied:
Nun liebe Kinder gebt fein acht
Ich bin die Stimme aus dem Kissen
Ich hab euch etwas mitgebracht
Ein heller Schein am Firmament
Mein Herz brennt
Assoziationen sind frei; und genau darum dreht sich das Video; und genau deshalb finden manche Zeitgenossen hier Riefenstahl und Hitler-Deutschland
Meine drehen sich um den Horror von Märchenwesen – zB. bei Buffy, Hush.
Rammstein – Mein Herz brennt
Franz Schreker (1878 - 1934)
Die Gezeichneten
Oper in drei Akten
Text vom Komponisten
Als am 25.April 1918 die Uraufführung von "Die Gezeichneten" im Frankfurter Opernhaus statt findet, ist man mitten in den letzten Kriegsanstrengungen: am 21.März 1918 beginnt der Versuch des deutschen Heeres, mit der Frühjahrsoffensive den Stellungskrieg zu beenden und am Ende doch noch einen Siegfrieden zu erzwingen.
Man muß sich diese Situation vor Augen halten: die Welt führt einen ihrer schlimmsten Kriege, der am Ende ca. 20 Millionen Tote fordern wird, in Deutschland ist die Zivilbevölkerung am Hungern - und man bekommt die Kräfte versammelt, um eine dreistündige, hochkomplexe Partitur einzustudieren und aufzuführen, die mindestens fünf hochkarätige Sänger-Solisten, einen Chor, und ein mehr als hundert Musiker umfassendes Orchester fordert.
Dann ist diese Oper noch ein großer Erfolg: im Jahr 1920 wird sie zum ersten Mal in Wien aufgeführt - und auf dem Plakat wird damit geworben, daß sie in den zwei Jahren zuvor bereits sechundsechzig(!) Mal in fünf(!!) Städten aufgeführt wurde. Dies findet statt in einer Zeit, die von den Kriegsfolgen noch nicht im Mindesten zur Ruhe gekommen, geschweige denn geheilt ist. Die Weimarer Republik wird ausgerufen und mit einem verheerenden Bündnis aus Sozialdemokraten und Freikorps blutig durchgesetzt, der Kapp-Putsch bringt das Land kurz vor einen Bürgerkrieg, die Städte sind voll von heimgekehrten Soldaten, die ihre Waffen noch bei sich tragenden, der Hunger ist wohlbekannter Begleiter im Alltag - und eine Musik feiert größte Erfolge, die in ihrer Komplexität bisher unerhört war, und völlig neue Wege geht.
Man muß sich diese Situation vor Augen führen, um eine Ahnung davon zu bekommen, was für einen Stellenwert Musik einst hatte, bevor sie der banale Krach des Straßenverkehrs, der ewige Hintergrund aus Kaufhausmusik und Techno-Gewummer, das Reden und Rufen in die Handys, gnadenlos übertönte.
Ohne Musik wäre das Leben ein Irrthum.
(Nietzsche)
Ich würde diesen Satz - auf unsere Zeit gewendet - so formulieren: In jenem Maß, in dem das Leben ohne Musik ist, zeigt sich dessen Irrsinn.
Bereits im Vorspiel wird jener impressionistische Klangteppich ausgebreitet, der so typisch ist für das Schrekersche Komponieren: man hört immer wieder satte Dur-Dreiklänge, die oft über Terzverwandschaften verbunden funktionslos in der Luft hängen - und über und in ihnen ein ganzes Knäuel aus schärfsten Dissonanzen, die freilich von Harfe, Celestra oder Marimbaphon wie hingehaucht daherkommen. Man kann das auf zweierlei Weise hören: stellt man die harmonische Struktur aus tiefen Streichern und Blech hervor, ist es leicht versteh- und sogar konsumierbar. Hält man sich an die Schicht der Dissonanzen, bekommt die Musik einen ruhelosen, verstörenden Charakter, der fast schon Angst auslösen kann.
Neben dieser Suche nach "Klang an sich" (eine Oper zuvor - im 1912 entstandenen "Der ferne Klang" - bezieht sich selbst das Textbuch auf dieses Thema) finden sich Annäherungen ans Belcanto, und - wie kann es anders sein - Bezüge auf die Überfigur des ausgehenden 19.Jh, Richard Wagner.
Neben dem Vorspiel wäre die Arie der Carlotta gegen Ende des ersten Akts herauszuheben: ein derart betörendenes Belcanto hat keiner der Italiener je hinbekommen; der einzige Vergleich, der mir einfällt - und der mir auch nach einigem Nachdenken nicht zu hoch gegriffen vorkommt - findet sich im Ende von Wagners "Tristan", in Isoldes Liebestod.
Gewöhnlich ärgere ich mich über jene Freunde der Oper, die sich freuen, wenn der Text "in Italienisch" ist, so daß sie ihn nicht verstehen und er sie nicht belästigt in ihrer Schwelgerei in schönen Stimmen. Oper hat einen Inhalt, und der teilt sich mit über ihr Buch. Die Musik hat hier natürlich keinesfalls eine illustrierende Funktion (wie man dies von heutiger Filmmusik gewohnt ist); sie kommentiert die Bedeutung des Textes, indem sie im Gesang und in der Begleitung des Orchesters Kontraste schafft, dem Wort widerspricht, oder ihm eine zusätzliche Ausdrucksebene verschafft. Den Text beiseite zu lassen, ist allein deshalb keine gute Idee, weil man sonst nicht versteht, woran die Musik sich reibt - dies gilt für alle Zeiten seit Monteverdi, für die Epoche seit Wagner erst recht.
Trotzdem kann ich Schrekers Text (der Komponist schrieb auch das Libretto) nicht lesen, ohne wieder und wieder in einem Anfall von Fremdschämen das Textbuch zu zuklappen und mir fest vorzunehmen, diese Oper aus meinem Gedächtnis zu streichen. Schon die Synopsis mag ich nicht erzählen, und wenn ich dann gezwungen würde, noch Beispiele zu zitieren, wäre ich in großer Not. - Sei's drum, aus einer Arie der Hauptfigur (Alviano) im ersten Akt:
Es gab Frühlingnächte. Bei offenen Fenstern tanzt es herein. Alle schwülen Zauber, Blumengeruch, schwer und betäubend.
Und ich mußte fort, geschüttelt von Fiebern, hinaus in einsame Gassen. Und suchte ein Dirnchen, so recht ein verkomm'nes. Sprach es an, bot ihr Gold, viel Gold und fühlte mich doch dem Bettler gleich, der Almosen heischt.
Einerseits ist das natürlich Fin de siêcle in Reinstform, wo (sexueller) Ausbruch und Verklemmtheit eins in eins gehen. Andererseits: wenn man bei Wagner blättert, wird man ebenso fündig - die Ring-Dichtung ist geradezu verseucht mit Textstellen, die man nicht lesen kann, ohne daß es einem die Schamröte ins Gesicht treibt. Insofern kann man Schreker sogar aus der Kritik nehmen: er hat den Übervater seiner Epoche überaus Ernst genommen, und auch dessen fragwürdige Seiten zu übertreffen versucht.
Witz beiseite: dies ist großartige Musik, man muß sie hören - einfach bloß hören, selbst wo dieses Vorhaben alles andere als "einfach" ist.
Die DECCA-Aufnahme aus der "Entartete Musik"-Reihe scheint es nur noch völlig überteuert zu geben - was wirklich schade ist: Elizabeth Connell singt dort eine außerordentliche Carlotta. Dafür gibt es aber seit letztem Jahr eine DVD, die ich nicht kenne, die aber eine vielversprechende Besetzungsliste aufweist (Anne Schwanewilms, Robert Hale) - ist bestellt, ich werde berichten.
Ich halte DIE GEZEICHNETEN für ein außerordentliches Werk. Der Einsatz von Klangfarben in fast mikroskopischer Abstufung wird kontrolliert durch Schrekers enorm versierte Orchesterbehandlung, die den Vorteil hat, dass sie eine bessere Balance zwischen Orchester und Sängern ermöglicht. Außerdem betont sie Schrekers revolutionäre und progressive Seite. Man kann seine Musik schön nennen, kann sie aber auch als äußerst beunruhigend bezeichnen. Denn es kommt selten vor, dass man eine Konsonanz oder die echte Auflösung einer Dissonanz spürt. Die Musik ist ständig in Unruhe, ständig in Bewegung.[1]
(Kent Nagano)
Robert Brubaker, Anne Schwanewilms, Michael Volle, Robert Hale, Wolfgang Schöne
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Kent Nagano
Salzburger Festspiele 2005
Gerade eben habe ich den ersten Akt auf der DVD gesehen und gehört - und war nach den ersten Takten derart verblüfft, daß ich abgebrochen und kurz die CD eingelegt habe: ich war einen Moment der festen Überzeugung, diese Musik noch nie gehört zu haben. Aber doch, da war keine falsche DVD in den Schacht geraten, die Noten sind dieselben.
Kent Nagano und sein Deutsches Symphonie-Orchester Berlin setzen die Partitur derart differenziert um, daß endlich die Leitmotive hörbar werden - und zwar nicht nur, wo sie erstmals überdeutlich vorgestellt werden, sondern auch überall dort, wo sie in den Nebenstimmen auftauchen. Da gibt es einen stetigen rhythmischen Fluß; wo die Musik große Bögen bildet, wird sie nicht durch ständige Temposchwankungen - womöglich mit einer Zerdehung jedes Taktendes, wie man das gelegentlich findet - daran gehindert, ihren Atem zu entfalten. Agogisch gestaltet werden hingegen Brüche in der Form, Übergänge, Fragen. Hin und wieder gibt es leises Gewackel in der Intonation (besonders die Holzbläser sind davon betroffen) - das mag ich aber kaum erwähnen, weil die positiven Aspekte dieser Leistung alle Kritik kleinlich wirken lassen.
Auch die Sänger sind überdurchschnittlich. Robert Brubakers Alviano leidet ein wenig an der englischen Färbung der Vokale, hat aber einen wirklich klangschönen Tenor, der das mehr als aufwiegt. Ich fand die Carlotta der Elizabeth Connell schon beeindruckend - Anne Schwanewilms steht dem aber nicht einen Millimeter nach, eher im Gegenteil: in Verbindung mit Naganos präzisem Verständnis für die dramatische Struktur der großen Arie, mit der der erste Akt schließt, kommt die außergewöhnliche Schönheit dieser Musik erst richtig zum Leuchten.
Wenn man eine Oper nur hört, fehlt definitiv Entscheidendes, auch wenn es nur darum geht, die Musik zu beurteilen: die ist schließlich, auch und gerade in der Intention des Komponisten, nur eine von mehreren Ebenen, die dem Publikum präsentiert werden. Das Geschehen auf der Bühne kann man am Bildschirm natürlich nur eingeschränkt wahrnehmen; man ist auf den Blick der Kamera verwiesen, und es fehlt die Unmittelbarkeit in der Wahrnehmung von räumlicher Tiefe. Dennoch findet sich hier ein m.E. akzeptabler Kompromiß.
Im abgedunkelten Zuschauerraum bei einer Live-Aufführung hat man keine Chance, im Libretto parallel mitzulesen - und selbst die besten Sänger singen gerade so textverständlich, daß man dem Text folgen kann, wenn man ihn auswendig kennt. Beim Schauen einer DVD kann man Untertitel einblenden und den Text im Zusammenhang verfolgen - ein Feature mit weitreichenden Konsequenzen.
- [1] Damit kommt Nagano meinem eigenen Urteil so nahe, daß der Verdacht entstehen könnte, ich hätte bei ihm abgeschrieben.
Gestern und heute Abend habe Akt 2+3 gesehen und gehört. An meinem vorläufigen Urteil kann ich festhalten, sogar noch einiges an Enthusiasmus hinzutun.
Der zweite Akt ist weitaus leiser - gleichsam gedämpfter getönt - als der erste. Er schließt ab mit einem ganz wunderbaren Duett zwischen Alviano und Carlotta, für das ich in der Operngeschichte keinen Vergleich finde: derart nuanciert zwischen Zweifel und Gewißheit hat sich zuvor noch kein Liebespaar gegenseitig angesungen.
Der dritte Akt ist mit seiner einzigartigen Behandlung des Chors sicherlich der Höhepunkt der Oper: einen Chor setzt "die Oper" gewöhnlich dann ein, wenn es laut werden soll, und man die Hörer mittels Massierung des Klanges zu überwältigen sucht - nichts davon hier. Nur ein Beispiel: nachdem der Herzog Alviano angeklagt und verurteilt hat, geht ein Murren und Zweifeln durch die Masse, die einfach nicht glauben mag, daß der Wohltäter zum Mädchenräuber wurde: die Behandlung des Chors in dieser Passage - zerflatterte Einzelstimmen zwischen punktuellen Statements vom Orchester - ist ohne Vorbild und schlicht grandios.
Im Abspann der DVD sieht man, wie das Salzburger Festspielpublikum die Protagonisten feiert. Ausnahmsweise trifft es die Richtigen: Anne Schwanewilms (Carlotta) bekommt ebenso Ovationen wie Robert Brubaker (Alviano), wie zuvor der auch darstellerisch überaus überzeugenden Michael Volle (Vitelozzo). Als Kent Nagano auf die Bühne gebeten wird, ist der Jubel auf dem Höhepunkt (wäre ich im Publikum gewesen, hätte ich sicherlich ein paar "Bravos" beigesteuert).[1][2]
- [1] Auch die für die Inszenierung verantwortliche Crew wird freundlich verabschiedet - sehr zurecht, wie ich finde, wobei ich keine rechte Lust habe, in die Details zu gehen.
- [2] In diesem Jubel (an dem ich mich selber gerade beteilige) geht freilich regelmäßig unter, welchen Preis man für ihn verlangte. Ich kann es hier nur andeuten: Schreker starb 1934 an Verzweiflung am Schicksal, das ihm der Größte Wagnerianer Aller Zeiten zugedacht hatte.
Siegfried Jerusalem, Sharon Sweet, Marjana Lipovsek
Wiener Philharmoniker
Claudio Abbado
Mit Arnold Schönberg (1874 - 1951) verbindet man i.d.R. Begriffe wie Zwölftonmusik und Atonalität, die Vorherrschaft der Dissonanz über den Wohlklang, des Intellekts über das Gefühl usw. usf. Ich könnte jetzt drangehen und mir diese und viele weitere Vorurteile eins nach dem anderen vornehmen - ich kann aber auch Schönberg selbst sprechen lassen.
Die Gurrelieder hat Schönberg zwischen 1899 und 1900 zunächst für Gesang und Klavier geschrieben, und in den folgenden Jahren immer wieder, soweit es seine prekäre Existenz zuließ, hervorgeholt und orchestriert; schließlich wurden sie (unter der Leitung von Franz Schreker) 1913 in Wien uraufgeführt. Schon zum Zeitpunkt ihrer ursprünglichen Konzeption um die Jahrhundertwende waren sie keineswegs ein kühner Aufbruch auf neuen Wegen, wie man dies von einem Fünfundzwanzigjährigen eigenlich erwarten würde; vielmehr besinnen sie sich nochmals auf das Vorbild Wagners, und fassen all jene Möglichkeiten zusammen, die der Gebrauch des Leitmotivs zur Schaffung großer formaler Bögen bietet.
Der Text von Jens Peter Jacobsen (1847-1885) ist eine tief romantische Variation des Tistan-Themas: König Waldemar eilt zu seiner Geliebten Tove, nur um diese tot zu finden; Gott verfluchend steigt er ihr nach ins Todesreich. Im dritten Teil klappern dann gelegentlich die Sargdeckel, wenn sein Gefolge sich beschwert, nicht sterben zu dürfen; aber auch eine Narrenfigur hält Vortrag und ironisiert die Jagd des Königs aus dem Grab heraus nach einer Toten.
Der Orchesterapparat (u.a. 8 Flöten, 10 Hörner, 6 Pauken, 5 Solisten, drei Männerchöre und ein 8-stimmiger Chor) ist riesig, und übertrifft selbst jenen von Mahlers Achter. Dabei wird nur an ganz wenigen Stellen richtig Krach veranstaltet; in erster Linie geht es um eine kammermusikalische, sehr verzwickte und komplexe Ornamentik. Grandios vorgeführt wird dies schon im Vorspiel: die Naturschilderung des beginnenden Tages wird vorgetragen von allen hohen Instrumenten, die einen dichten Es-Dur-Teppich weben, indem sie in überlagernden rhythmischen Schichten keinen klaren Puls erkennen lassen. Das hört sich an wie ein vom beginnenden Sonnenlicht beschienenes Spinnennetz, das ein leichter Windhauch bewegt und zum Glitzern bringt.
Es ist müßig, die zahlreichen Einfälle und Wendungen aufzuzählen - hier ist ein Komponist am Werke, dem die Ideen nicht ausgehen, und der ein den Text verblüffend präzise kommentierendes Motiv dem nächsten folgen läßt. Hervorzuheben wären - neben dem Vorspiel - das "Lied der Waldtaube" am Ende des ersten Abschnitts, das schon eine eigene, in sich geschlossene Oper darstellt, sowie der letzte der beiden Männerchöre, der in seiner mit differenziertesten musikalischen Mitteln gestalteten Todessehnsucht sich deutlich an Wagners Parzival-Chöre anlehnt, und über diese hinausreicht.
Wenn es je etwas wie "Jugendstil" in der Musik gegeben hat - hier kann man ihn finden.
Das "Lied der Waldtaube" führt ein von den Gurreliedern getrenntes eigenständiges Leben, weil es von ihm eine Fassung für Kammerorchester gibt, die Pierre Boulez seit vielen Jahren in seinem Repertoire hat. Mir gefällt diese Version fast besser als die Fassung für großes Orchester, weil sie viel klarer durchhörbar ist und die Struktur des Werks fast analytisch offenlegt. Hinzu kommt, zumindest in der vorliegenden Aufnahme, daß die Rhythmik in ihrem Schwanken zwischen starkt zerdehnten, fast zum Erliegenden kommenden Passagen und einem klar akzentuierten Marsch sehr sauber umgesetzt wird, so daß die Kontraste offensichtlich werden.
Solche Bearbeitungen von großen Besetzungen für den "Hausgebrauch" haben eine längere Tradition in der gesamten Romantik. Man denke nur an die Transkriptionen berühmter Sinfonien für Klavier zu zwei oder zu vier Händen, die dabei helfen sollten, diese über den Umweg über die bürgerlichen und adeligen Salons zu verbreiten und zu popularisieren. Gerade im Wien der Jahrhundertwende gab es aber auch zahlreiche Bearbeitungen groß angelegter Werke für kleine Besetzungen, die in privaten Musikvereinen zur Aufführung kamen. Das mag daran liegen, daß etwa die Bearbeitung einer Mahler-Sinfonie für Klavier selbst für einen engagierten Dilettanten technisch kaum zu bewältigen ist, und zudem unter Verzicht auf jede orchestrale Farbe eher ernüchternd wirkt denn als Quelle der Inspiration. Schönbergs Bearbeitung von Mahlers "Lied von der Erde" hingegen vermittelt ein präzises Bild auch der klanglichen Struktur des Werks, obwohl sie "nur" 16 Musiker erfordert.
Das ist schon ein spannender Aspekt: als die Musik derart überhöht wurde, daß ihre gigantischen Orchester nur noch in die größten Säle paßten und einem Hunderte, ja Tausende zählenden Publikum präsentiert wurde, war sie gleichzeitig derart komplex geworden, daß sie immer weniger Zuhörer anzog, und ihre Hybris nur noch verbreiten konnte, indem sie sich in die Kammer zurückzog.
Mozart: damit habe ich lange Jahre nichts anfangen können - das war ein Pseudonym für Nachtmusik und simpel und vorhersehbar, ich fand das schlicht langweilig. Da aber nahezu jeder bedeutende Musiker in den letzten 250 Jahre voller Staunen vor Mozarts Musik gestanden hat, habe ich immer schon vermutet, daß man vielleicht ein gewisses Alter erreichen müsse, um sie zu mögen (so ist es auch gekommen).
Bei Schubert war ich mir stets sicher, daß er mir nie etwas zu sagen habe - das war in meinen Augen der Komponist von Liedern im Volkston, die im Biedermeier dem Kleinbürgertum den Abend im Salon versüßten, von niederschmetternder Innerlichkeit, reaktionär bis in die Knochen.
Aber das ist natürlich ein völlig falsches Bild, ungefähr vergleichbar mit jenem, das zum Begriff der Romantik kitschige Sonnenuntergänge und schwülstige Liebesschwüre assoziiert.
Im Zentrum des romantischen Lebensgefühls steht das Empfinden, die profane Realität sei nur eine Hülle, die einen profunden Blick auf die Wahrheit der Dinge wie ein Schleier umgibt. In den Märchen ETA Hoffmans etwa ist der Philister einer phantastischen Welt entgegengestellt, die er leugnet und nicht wahrhaben will, die dennoch die eigentliche, die erfüllte Wirklichkeit darstellt. Wahrgenommen wird ein tiefer Bruch zwischen der äußeren Realität und der inneren Welt, der Sphäre der Innerlichkeit.
Dabei erweist sich diese Wahrnehmung nur beim allerersten Hinsehen als Flucht vor Gesellschaft und Politik.

Franz Schubert
Fremd bin ich eingezogen
fremd zieh' ich wieder aus.
Dies sind die ersten beiden Zeilen der Winterreise, Franz Schuberts Zyklus von vierundzwanzig Liedern nach Gedichten von Wilhelm Müller. Sie benennen bereits das ganze Programm, dem Dichtung wie Musik folgen. Es geht um das Gefühl des Verlustes jeder Heimat, genauer: um die Sehnsucht nach einer Heimat, die man niemals hatte. Allen Träumen folgt brutalstes Erwachen, jede Hoffnung wird im Ansatz zerstört. Selbst die urromantische Vorstellung, die Realität an der Kunst zu heilen, wird im Ansatz verworfen. Die Winterreise ist eine Reise in den Tod, dem keine Auferstehung folgen wird.
"Am Brunnen vor dem Tore", das fünfte Lied im Zyklus, ist zum Volkslied geworden, weil man es gnadenlos glattgebügelt und mißverstanden hat - und ist insofern symptomatisch für das gesamte Bild, das sich über Schubert hartnäckig in den Köpfen hält. - Der Reisende erinnert sich an einen "Lindenbaum", unter dem er einst manch "süßen Traum" erlebte. In zwei von fünf Strophen wird aber die momentane Situation unmißverständlich klar gemacht:
Die kalten Winde bliesen
mir grad' ins Angesicht
In Schuberts Original spiegelt das die Musik, und zwar auch in den träumenden Strophen: von der Seeligkeit des Eingangs (den die Volksliedversion schlicht wiederholt) bleibt nur die Melodie übrig. Das begleitende Klavier irrt in zerklüfteten, fast pointilistischen Phrasen umher, und findet nicht mehr zurück zu den volltönend-schlichten Kadenzdreiklängen des Anfangs.
Die letzten beiden Lieder sind von einer Trostlosigkeit, die sich selbst in der Moderne kaum wiederfindet. Die "Nebensonnen" (an vorletzter Stelle) scheinen zunächst unverständlich:
Drei Sonnen sah ich am Himmel steh'n,
hab' lang und fest sie angeseh'n;
und sie auch standen da so stier,
als wollten sie nicht weg von mir.
Ach, meine Sonnen seid ihr nicht!
Schaut andern doch ins Angesicht!
Ja, neulich hatt' ich auch wohl drei:
nun sind hinab die besten zwei.
Ging nur die dritt' erst hinterdrein!
Im Dunkeln wird mir wohler sein.
Dabei liegt eine Deutung nahe, wenn man den Kontext der anderen Lieder einbezieht: die drei Sonnen sind Kindheit, Jugend, Alter; die Hoffnung, die bleibt, liegt im Dunklen, im Tod.
Das letzte Lied des Zyklus, der Leiermann, bekommt noch einen eigenen Eintrag (es gibt eine berühmte Deutung von Hans Heinrich Eggebrecht - in seiner glänzenden Musikgeschichte "Musik im Abendland" - , die sehr präzise auf dem Punkt ist).
Der Leiermann
Drüben hinterm Dorfe
steht ein Leiermann;
und mit starren Fingern
dreht er, was er kann.
Barfuß auf dem Eise..
So geht das weiter, vier Strophen Eiseskälte. Schließlich, die letzte:
Wunderlicher Alter,
soll ich mit dir geh'n?
Willst zu meinen Liedern
deine Leier dreh'n?
Wie komponiert Schubert das? – gar nicht: er läßt den Leiermann spielen; er nimmt ihn in die Musik hinein.
Über einem Orgelpunkt auf A repetiert das Klavier eine immer gleiche, rhythmisch verschobene pentatonische Phrase, die man so auch auf einer Leier spielen könnte. Der Text wird fast im Sprechgesang vorgetragen – da ist nicht einmal die Ahnung einer Melodie. Von der ersten Note an ist klar, daß die Befürchtung des letzten Satzes längst wahr wurde: der Ich-Erzähler singt zur Begleitung des alten Mannes, und die Frage – ob er mit ihm gehen soll – wurde letztlich schon in der ersten Strophe beantwortet: das tut er längst.
Das ist beinahe schon eine Montage, ein Hereinnehmen von Realität in ein Kunstwerk, wie man es in der bildenden Kunst bei Duchamp zuerst erblickte – und was in der Musik gar nicht erst vorkam (vielleicht mit Ausnahme der Musique concrète Pierre Schaeffers, in einer ganz anderen künstlerischen Liga).
Aber wovon erzähle ich hier eigentlich? – man muß dies hören! - und verweise zurück auf den Eintrag über die Aufnahme der Winterreise von Hampson&Sawallisch.
Wolfgang Sawallisch, Klavier
Nach fast zwei Wochen hatte ich heute Abend wieder die innere Ruhe, Musik zu hören.
Die CD steht schon länger in meinem Regal - ich hatte beim ersten Hören rasch
abgebrochen, weil ich mit Hampsons englisch gefärbtem Deutsch nicht klar kam.
Beim Wiederhören fand ich das weniger schlimm - er bekommt kein einem Vokal
folgendes "r" richtig hin, ein "Ort" wird zum "Oht", aus "Arm" wird "Ahm" usf.
Das war es aber schon, von englisch sprechenden Sängern ist man weitaus
schlimmeres gewohnt.
In jeder anderen Beziehung ist diese Aufnahme aber eine echte Empfehlung, ich behaupte einfach mal frech: sie setzt einen neuen Maßstab - dies, obwohl die "Winterreise" zu den meist aufgenommenen Werken der abendländischen Musik überhaupt zählen dürfte. Gründe:
- Wenn ich das richtig höre (ich muß das an den Noten noch prüfen), werden die Originaltonarten beibehalten. Das hört sich nichtig an, ist aber im Gegenteil ein wichtiges Argument gegen Fischer-Dieskau (der da schummelt und die Lieder in für ihn vorteilhaft singbare Tonarten transponiert): es gibt spätestens seit Bach eine Dramaturgie der Tonartbeziehungen in einem Zyklus, die ebenso wichtig ist wie der tonale Verlauf im individuellen Satz (/ Stück / Lied).
-
Rhythmisch sind Hampson und Sawallisch äußerst präzise, ohne zu
erstarren: bei Schubert gibt es öfters achteltriolische Figuren gegen
eine Begleitung aus punktierter Achtel + Sechzechtel.
Das letzte Triolenachtel wird dann von dem Sechszehntelachtel - ganz knapp, das ist nur eine Nuance - gleichsam verfolgt. Wie gesagt: ganz knapp ist das - und hier geht es auf, und zwar ohne das Gefühl auszulösen, es ginge um den Effekt, es sei pure Zahlenhuberei oder Schlimmeres, unter Verzicht womöglich auf sinnvolle agogische Gestalltung. Wenn man den Vergleich hört, ist das weit weniger abstrakt als meine Beschreibung: es ist von unmittelbarer Evidenz. Man man wundert sich bloß noch, warum das nicht alle so machen.

- Alle Lieder haben eher zügige Tempi, ohne hastig zu klingen. Hampson wie Sawallisch sind - wie viele Jazzer - in der Lage, das Tempo zu halten, aber "hinter dem Beat" - laid back - zu spielen. Bei "Klassikern" kommt sowas eher selten vor, umso verblüffender klingt das, wenn alle Beteiligten das können.
- Hampson singt von sehr leise bis äußerst laut, jedoch: er schreit nicht. Man vergleiche Fischer-Dieskau (der ja als Referenz schlechthin gilt) - ich schenke mir da jeden weiteren Kommentar.
Wenn man bei Schuberts a-moll-Sonate raten sollte, wer ihr Autor ist, würde man alles mögliche tippen, nur eben nicht Schubert - zumindest, wenn man es nicht besser weiß und ihn (so wie ich lange Jahre) für den Komponisten von beschaulichen Liedern im Volkston hält.
Der erste Satz - mit "Moderato" überschrieben - ist geradezu eine Parodie[1] auf den Gedanken des Sonatenhauptsatzes. Es ist kaum möglich, ein zweites Thema von diversen Überleitungen zu unterscheiden. Das erste Thema wird immer wieder, in leichten Variationen, wiederholt, ohne daß es zu einer echten thematischen Arbeit, zu einer Entwicklung käme. Dann gibt es mehrfach einen von einer Generalpause quittierten Abbruch im pianissimo - als ob völlig unklar wäre, ob und wie es weiter geht.
Auch die übrigen Sätze sind geprägt von solchen Brüchen - als würde jemand verzweifelt fragen, was nach all dem Elend folgen soll. Das erinnert überhaupt nicht an Beethoven (der zum Zeitpunkt des Entstehens der Sonate (1825) noch am Leben und im Zenit seines Ruhmes war), sondern an die Mondlandschaften Bruckners - bloß daß Schubert nicht die klanglichen und dynamischen Möglichkeiten eines Riesenorchesters braucht, um sie zu malen.
Mich erstaunt im nachhinein, wieso ich derart lange gebraucht habe, um zu Schuberts Musik Zugang zu bekommen. Ein Hindernis immerhin kenne ich jetzt: die ersten fünfhundert im Deutsch-Verzeichnis katalogisierten Werke hat Schubert geschrieben, als er im Alter zwischen sechzehn und neunzehn Jahren sein Handwerk lernte - und in diese Reihe gehören immerhin sechs der acht Sinfonien. Die zweite Hälfte seines Schaffens ist qualitativ völlig davon losgelöst [2] - hier gibt es m.E. nicht ein einziges schwaches Werk, vielleicht sogar keine mißratene Note.
- [1] Der Begriff Parodie konnotiert heute hauptsächlich spöttische Übertreibung; gemeint ist mit dem Wort aber in erster Linie Verzerrung.
- [2] Es gibt hier gewisse Parallelen zu Mozart, der schon als Kind Proben eines unglaublichen Talents abgegeben hat, das aber erst nach einer umfassenden Ausbildung wirklich zur Geltung kam.
Von den letzten drei Klaviersonaten Schuberts ist die in B-Dur die berühmteste - sehr zu Recht übrigens. Man sollte dabei aber nicht den Fehler machen, die beiden anderen Sonaten (in c-moll bzw. A-Dur) zu ignorieren: sie gehören zum Höhepunkt von Schuberts Schaffen, und damit zu dem der gesamten abendländischen Musiktradition.
In der A-Dur-Sonate ist der zweite, langsame Satz geradezu ein Paradebeispiel für Schuberts Kompositionsstil. Er beginnt mit einem wunderschönen, klagendem Lied in fis-moll, das sich in einer nicht enden wollenden Melodie ergeht. Dabei ist dies kein naiver Kitsch im Gewand eines Volkslieds, sondern von außerordentlicher harmonischer Raffinesse (die sich freilich erst erschließt, wenn man genau hinhört). - Plötzlich bricht das ab. Es folgt ein Gewitter aus verminderten Septimakkorden im Fortissimo und aufgeregten Arpeggien, nur scheinbar aufgelöst von einem Durakkord, der in hoher Lage von einem Baß in Quintlage und tiefstem Register begleitet zur scharfen Dissonanz wird. Das Hauptmotiv des Themas kommt zögerlich und unbegleitet daher, nur um von Akkorden in extrem auseinandergerissener Lage und größter Lautstärke unterbrochen zu werden. Dieses Spiel wiederholt sich mehrfach. Endlich beginnt, nach einer Generalpause, die Reprise des Hauptthemas - welches jetzt allerdings noch die letzte Naivität abgestreift hat, und von den Vorhaltsdissonanzen einer neu hinzutretenden Oberstimme in trübes Licht getaucht erscheint.
Hier - wie in vielen anderen Werken auch - führt Schubert vor, wie sich das Verzweifeln an der Welt musikalisch formulieren läßt. Weit weg davon, einfach nur den formalen und harmonischen Rezepten seiner Vorgänger ein paar neue Details hinzuzufügen, nimmt er die vorgefundenen Regeln, um mit ihnen einen völlig neuen Inhalt zu gestalten. Da gibt es nicht mehr die Idee der Klassik von "edler Einfalt und stiller Größe", der die Forderung nach dem in sich geschlossenen Kunstwerk zur Seite steht; statt dessen findet man die Urgestalt des romantischen Menschen, der an der Realität leidet, und trotz aller Märchenwelten und Kunstgestalten, mit denen er zu ihr ein Gegengewicht schaffen will, letztlich an ihr scheitert.
Die Schubert-Interpretationen Maurizio Pollinis brauchen einen eigenen Eintrag - dessen Auffassung von Agogik bringt mich momentan dazu, nochmals über zentrale Wesensmerkmale von Rhythmik nachzudenken. - Ich komme auf das Thema zurück.
Esperanza Spalding spielt Kontrabaß, und singt - und zwar beides gleichzeitig. Allein das wäre schon bemerkenswert, weil dieses Doppel völlig neu ist. Scat-Gesang im Unisono mit einem zwei Oktaven tiefer stehenden Baß hat es bislang noch nicht gegeben - und was an anderer Stelle Spalding in Sachen Polyphonie zwischen Gesang und Begleitlinien abliefert, ist streckenweise völlig unglaublich, wenn man nicht vergleichbare Dinge von Sängern kennen würde, die sich selbst mit der Gitarre begleiten.
Dabei ist sie gerade 24 Jahre alt, jüngste Dozentin aller Zeiten an der renommierten „Berkley School of Jazz”, und hat keinen geringeren als Pat Metheny zum Protegé. - All dies ist außergewöhnlich genug, um selbst die „Süddeutsche" dazu zu bewegen, diesem Ausnahmetalent einen Artikel zu widmen (leider nicht online).
Auf der CD finden sich größtenteils Stücke in „Even Eights” (geraden Achteln), die an die alten Tage der Verschmelzung von Jazz, Rock und lateinamerikanischen Rhythmen anknüpfen. Das sind z.T. recht komplexe Grooves, in die man sich eine Weile hineinhören muß, um herauszubekommen, daß man es z.B. mit einem 6/4-Takt zu tun hat - vielfach stehen schwere und leichte Zählzeiten völlig gleichberechtigt nebeneinander, und die „1” des Taktanfangs ist gut versteckt. Es gibt auch zwei eher unspektakuläre ruhige Nummern - und zwei swingende Stücke, in denen der Baß keinesfalls einen monotonen „Walking” mit durchgehenden Vierteln spielt, sondern sich zusammen mit dem Schlagzeug vehement in die Improvisationen einmischt.
Das alles findet auf einem technisch derart hohem Level statt, daß ich mir nur verblüfft die Augen gerieben habe - Spalding spielt einen Baß, der sich definitiv auf Augenhöhe mit meinen großen Vorbildern befindet, ob sie nun Dave Holland, Gerry Peacock oder Marc Johnson heißen. Dabei hat sie trotzdem - mit 24! - einen eigenständigen Stil, den ich jederzeit wiedererkennen würde. - Der Gesang ist technisch ebenfalls auf denkbar höchstem Niveau. Sie kann komplexe Linien - mit großen Sprüngen oder heiklen Tensions - in hohem Tempo und makelloser Intonation abfeuern, ohne daß es auch in den hohen Registern im mindesten bemüht oder unsicher klingt. Die Stimme selber ist eher unauffällig - ein klarer und offener Sopran, allerdings ohne Kanten oder Eigenheiten.
Meine einzige - allerdings grundlegende - Meckerei betrifft die Stilistik: das klingt alles wie aus dem Lehrbuch (wenn auch aus einem, das noch nicht verlegt war, als ich selber an die Uni ging). Jede Akkordwendung wie letztlich auch die rhythmischen Konzepte kennt man seit mittlerweile mehr als dreißig Jahren. Es ist kein Zufall, daß in diesem Zusammenhang der Name „Pat Metheny” fällt. Als dessen Debutalbum („Bright Size Live”) 1974 erschien, war er sogar noch jünger - gerade 20 (und hatte mit Jaco Pastorius einen E-Bassisten an der Hand, der stilprägend für das neue Instrument war wie sonst keiner). Es erschien zu einem Zeitpunkt, als unter dem ECM-Label zahlreiche ähnliche Alben veröffentlicht wurden, auf denen eine ganze Reihe von Musikern ihre Versuche dokumentierten, einen eigenen Weg zwischen Jazzrock und Freejazz zu finden. - Damals wurden letztlich all jene Konzepte bereits erprobt, an die Spalding heute anknüpft.
Man verstehe mich nicht falsch: das ist ein großartiges Album - nur dokumentiert es letztlich die Verwandlung eines Experiments in die vorherrschende Lehrmeinung an den Universitäten (den Plural kann man, wenn es um Berkley geht, ruhig verwenden: was sich dort durchsetzt, wird in kürzester Zeit auch überall anders zum Standard). Wo ich vor mehr als zwanzig Jahren noch mit Dozenten konfrontiert war, die bei Hard- und Bebop stecken geblieben waren, scheinen heute jene Musiker den Lehrbetrieb zu dominieren, die vor dreißig Jahren echtes Neuland betraten. Das ist zwar nicht wirklich verwunderlich, für mich jedoch neu - und letztlich eine völlig verblüffende Erkenntnis.
"Ich möchte deinen Mund küssen", sang sie auf ihrem Stuhl hinter dem Kneipentisch leise vor sich hin. Es war nach der Aufführung einer unbekannten italienischen Oper auf der Bühne einer Kleinstadt, in der sie eine der ersten Hauptrollen ihrer jungen Sängerlaufbahn hatte, und längst nach Mitternacht - kein Alkohol, man hatte noch erregt über die Vorstellung des Abends diskutiert, versackte langsam in allgemeiner Müdigkeit. Sabine war mir über zwei Ecken bekannt, wir sind uns an diesem Abend zum zweiten Mal nach Jahren über den Weg gelaufen (ich saß vorher noch im Publikum), und ich hatte nur beiläufig ihr Singen bemerkt. Aus meinem eigenen Halbschlaf ein wenig wach werdend antwortete ich, mit reichlich ungelenker Stimme, aber offenkundig erkennbar: "Jochanaan". Sie richtete ihren Körper auf und etwas ungelenkt den Zeigefinger in meine Richtung, sah mir in die Augen und sagte: "Genau!". Wenn - und falls - wir uns wieder begegnen, bin ich sicher, daß sie diese Szene ebenso glasklar erinnert, wie ich dies gerade tue.
Richard Strauß: Salome
Nielsen, Hale, Goldberg, Silja
Danish National Radio Symphony Orchestra
Michael Schonwandt
Chandos 1999
Ich hatte das Glück, Inga Nielsen öfters als Teil der Stammbesetzung der Hamburger Oper zu hören, u.a. als Elsa, aber eben auch als Salome. Mich begeistern Stimmen, die auch ohne (pseudo)dramatisches Vibrato Durchschlagskraft haben, nicht nur in den oberen Registern, sondern auch wenn es schwierig wird, nämlich in der Mitte und womöglich sehr tief unten - und einen Sopran aus dieser Kategorie hat die Nielsen zweifellos vorzuweisen. Dazu kommt ein ganz anrührender Ton, wenn sie sehr leise und fast ungestützt singt: das klingt dann fast, als wäre es die Stimme eines kleinen Mädchens.
Aber auch der Rest der Sängerschaft ist erstklassig, allen voran der Ehemann der Nielsen, Robert Hale. Orchester und Aufnahmetechnik sind aber leider höchstens Durchschnitt - bei einer Besetzung mit über hundert Musikern ist das ein echtes Handicap; es fällt mir schwer, die Aufnahme zu hören ohne Partitur in der Hand.
Auf Richard Strauss (1864-1949) werde ich später zurückkommen - müssen, leider, mit schwerem Herzen, es führt kein Weg daran vorbei, es ist ein ganz schwieriges Thema
City of Birmigham Symphony Orchestra
Paavo Järvi
ECM New Series, 2003
Erkki-Sven Tüür ist 1959 in Estland geboren, gründete als Jugendlicher eine in seiner Heimat durchaus populäre Rockband, und wurde zum Komponisten am Konservatorium in Tallin Anfang der Achtziger ausgebildet. Dieses Pendeln zwischen Pop und "Klassik" merkt man auch seiner Musik an: sie speist sich aus unterschiedlichsten Stilen. Mich erinnert das öfters an den Minimalismus in der Ausprägung durch John Adams, wo stark rhythmisierte Passagen in immer enger geführten Clustern gesteigert werden, um - im Abbrechen - eine neue Schicht freizulegen, die zuvor in der Komplexität verborgen war. Tüür schreibt aber auch sehr ruhige Sachen - solche, die sich nicht vor der Nähe zur Tonalität fürchten, sondern mit Reibungen spielen, die den ihnen zugrundeliegenden Drei- oder Vierklang eher offenkundig machen, als ihn zu verstecken.
Das Violinkonzert bietet einen guten Einstieg nicht nur in das Werk eines begabten Komponisten aktueller Kunstmusik, sondern generell in den "Elfenbeinturm" der Postmoderne - und der ist keineswegs so weit weg von der Realität - sprich: der Hör- und Erschließbarkeit -, wie mancher befürchtet, der mit "ernster" Musik nach 1945 immer noch die Experimente der Seriellen Musik oder die elektronischen Geräuschkulissen Stockhausens assoziiert. Wie bei vielen anderen Komponisten seiner Generation geht es Tüür nicht um den Versuch, um jeden Preis Neuland zu entdecken (nur um frustriert feststellen zu müssen, daß dieses längst besiedelt ist), sondern er schreibt mit einer gewissen Unbekümmertheit nichts Unentdecktes, aber ebensowenig altbekannt-Langweiliges.
Ich mache gar nicht erst den Versuch, das dreisätzige Werk genauer zu analysieren - es erschließt sich jedem, der unbefangen zuhört, ganz selbstverständlich. Es gibt keine intellektuell überhöhten Verrenkungen, die eh kein Mensch hörend nachvollziehen kann, sondern ein intelligentes Musikantentum, das Form aus Kontrasten entstehen läßt, und Strukturen aus Bausteinen schafft, die man auf Anhieb erinnern kann.
Tüür ist nicht der neue Mozart, und ich vermute, daß er keine eigene Schule begründen oder gar in zweihundert Jahren zu den Großen seiner Zeit gezählt werden wird. Seine Musik ist jedoch - im Spannungsfeld zwischen popkultureller Verblödung und nur noch für den Intellekt gebauten Werken der Avantgarde - etwas, was höchst selten wurde: hörenswert.
Das Werk selber ist mir zu wichtig, um es bei einer kurzen Besprechung bewenden zu lassen - ich habe an anderer Stelle mit einem Bericht zumindest begonnen. Hier folgen drei Hinweise auf empfehlenswerte Einspielungen.
Eine ganz außerordentliche Aufnahme gibt es von Carlos Kleiber, aufgenommen 1982 mit der Staatskapelle Dresden, mit einer auf den ersten Blick ungewöhnlichen Sängerschaft: René Kollo (ja, genau der René Kollo) - Tristan; Margaret Price (eine bekannte Mozartsängerin) - Isolde; Fischer-Dieskau - Kurvenal. Man bekommt hier eben keinen "typischen" Wagnergesang zugemutet, bei dem aus voller Seele ein Vibrato hingelegt wird, durch das man eine ganze Stuhlreihe werfen könnte; vielmehr wird mit sehr kontrolliertem Ausdruck gesungen (ja, auch von Kollo, obwohl man das kaum vermuten würde); gerade der strahlende Sopran von Margaret Price ist betörend.
Der eigentliche Star ist hier jedoch das Orchester, das weit mehr tut als nur den Gesang zu begleiten (wobei das bei Wagner ja eh nicht anders geht). Kleiber entwickelt die Partitur in einer Plastizität, die an einigen Stellen zentrale Details enthüllt, die mir zuvor noch beim Lesen der Noten entgangen waren. - Eigentlich wäre das die ganz große Empfehlung - mir fehlt aber eine Aufnahmetechnik, die das Riesenorchester wirklich "in den Raum stellt". In den achtziger Jahren war man mit der digitalen Technik noch ganz am Anfang, und das hört man hier leider deutlich.
Das Medium der DVD ist besser als jedes andere dazu geeignet, den Einstieg in eine Oper zu finden, die man noch nicht kennt: man kann sich nämlich Untertitel einblenden lassen. Auf diese Weise versteht man den Fortgang der Handlung, ohne daheim ständig im Text mitzublättern, oder, bei einer Live-Aufführung, diesen gar auswendig kennen zu müssen. - Der Mitschnitt einer Aufführung an der Bayrischen Staatsoper unter Zubin Mehta hat zwei extreme Stärken, und leider eine ebenso bedeutende Schwäche.
- Die Isolde der von mir hoch geschätzten Waltraud Meier ist die beste Interpretation der Rolle, die derzeit zu haben ist: das ist die gestalterische Intelligenz einer Liedsängerin, verbunden mit einer unglaublichen Stimmgewalt. Ich habe die Meier mehrfach live erlebt, und ich muß all die enttäuschen, die vermuten, die Stimme sei nur mit Mitteln der Aufnahmetechnik in der Lage, sich über ein volles Orchester im fortissimo zu setzen: das geht auch ohne Mikrophon, und zwar sogar textverständlich, und ohne tremolierendes Schreien.
- Die Inszenierung von Peter Konwitschny ist frech, witzig, kontrovers, und auf den Punkt - frech und witzig, weil z.B. im ersten Akt die große Kontroverse zwischen Tristan und Isolde ausgerechnet in dem Moment losbricht, als Tristan mitten am Rasieren ist, und er folglich mit einem halb von Rasierschaum verzierten Gesicht die Debatte um Schuld und Todestrank führen muß; oder weil im zweiten Akt, in der zentralen Liebes- und Sterbe-Wollen-Szene, Tristan als erstes - unter lautstarkem Rumpeln - ein quietschend buntes Sofa auf die Bühne zerrt. Kontrovers - denn genau so will diese Oper mindestens 90% des Publikums nicht aufgeführt sehen. Konsequent schließlich, weil die Darsteller nicht allein gelassen werden, sondern mit einem einzigartigen Timing geführt werden, das allen Konwitschny-Inszenierungen gemeinsam ist (beispielsweise stehen die Sänger, wenn sie zu singen haben, immer am Bühnenrand und zum Publikum gerichtet - um nur einen, dabei keineswegs unwichtigen Punkt zu nennen) [1].
- Das große Manko - leider - ist der Tristan von Jon Frederic West. Ich stelle das mal als private Meinung ohne nähere Begründung in den Raum.
Schließlich meine Referenzaufnahme: Daniel Barenboim mit den Berliner Philharmonikern, wieder mit Waltraud Meier als Isolde, diesmal aber mit einem ebenbürtigen Tristan an ihrer Seite: Siegfried Jerusalem. Auch die "Nebenrollen" sind in Falk Struckmann (Kurvenal), Marjana Lipovsek (Brangäne), und dem ganz fabelhaften Matti Salminen (König Marke) bestmöglichst besetzt.
Barenboims Dirigat ist untadelig, aber auch - natürlich - nicht mit jenem Kleibers vergleichbar. Die Berliner klingen unglaublich gut, und zwar quer durch alle Instrumentengruppen, ohne jene "Peaks" wie etwas bei den Streichern der Wiener, oder den Holzbläsern beim Gewandhaus. Die Aufnahmequalität schließlich ist über alle Zweifel erhaben - eine vernünftige Anlage vorausgesetzt, erlebt man ein Orchester im eigenen Wohnzimmer, bei dem man fast schon jedes einzelne Pult der Geigen orten kann (man kann z.B. hören, daß Barenboim - leider - die Celli hinter den ersten Violinen plaziert, statt sie ihnen gegenüber rechts an den Bühnenrand zu setzen).
- [1] Peter Konwitschny war fünf Jahre lang der Lieblingsregisseur des Generalmusikdirektors der Hamburger Oper, Ingo Metzmacher - zu meinem großen Vergnügen. Über das Hamburger Musikleben muß ich demnächst noch die eine oder andere Anmerkung loswerden.
Von Richard Wagner gibt es neben seinen Opern kaum kleinere Werke. Kammermusik spielt in seinem Schaffen überhaupt keine Rolle, und auch Gelegenheitskompositionen wie etwa ein Kalenderblatt für das Klavier fehlen (fast) völlig. Schon deshalb fallen die Wesendonck-Lieder heraus, zeigen sie doch ausnahmsweise auf kleinstem Raum all das, was für Wagners Musik typisch ist.
Die fünf Lieder nach (unbedeutenden) Texten jener Frau, die Wagner damals liebte, Mathilde Wesendonck, Gemahlin seines Gönners Otto Wesendonck, entstanden in der unmittelbarer Vorarbeit zu „Tristan und Isolde”. Sie zeigen nicht nur den radikalen Weg, den Wagners Harmonik zu jener Zeit (1857) einschlug, sondern enthalten Material, das nur leicht variiert direkt in den „Tristan” einging. Im letzten Lied („Träume”) findet sich viel aus der Harmonik des zweiten Akts aus dem Tristan, im „Sink hernieder, Nacht der Liebe”-Duett der beiden Protagonisten. Das dritte Lied („Im Treibhaus”) - das längste, und m.E. auch bedeutendste aus dem Zyklus - bereitet das Material für den Beginn des dritten Tristan-Akts nicht nur vor, sondern wird dort dann fast wörtlich übernommen.
Wenn man sich einen kurzen Eindruck vom typischen „Wagner-Sound” verschaffen will, wird man in der knappen halben Stunde, die diese Lieder dauern, gut bedient. Man muß das allerdings unter gewissen Vorbehalt stellen, weil die Orchestrierungen bis auf eine Ausnahme nicht von Wagner selber stammen, sondern von seinem getreuen Lehrling, Felix Mottl. Das ist zwar solides Handwerk, kommt aber an die Behandlung des Orchesters durch den „Meister” nicht im Entferntesten heran[1].
Es gibt einen ganzen Schwung von Einspielungen des Zyklus - trotzdem besitze ich genau eine, und will auch gar nicht mehr. Waltraud Meier ist in meinen Augen die derzeit beste Besetzung für die Rolle der „Isolde”, und damit auch prädestiniert für den Vortrag der Wesendonck-Lieder. Die Klangqualität der Erato-Aufnahme ist zwar reichlich zweifelhaft, reicht aber aus, um ihr ganz unglaubliches Ausdrucksspektrum zu transportieren[2].
- [1] Es gibt eine alternative Instrumentierung der Lieder durch Hans Werner Henze, die komplett anders klingt als die Bearbeitung Mottls, obwohl sie Note für Note wörtlich die Noten Wagners umsetzt. Ich habe irgendwann eine Aufführung im Fernsehen gesehen, bislang aber leider keinen Mitschnitt auf CD gefunden (Nachtrag: Ich habe doch noch eine Aufnahme gefunden.
- [2] Ich hatte an anderer Stelle bereits davon berichtet.
Alexander Zemlinski (1871-1942) gehört zu jenem Kreis, der sich um die Jahrhundertwende in Wien um Gustav Mahler versammelte, um der Musikgeschichte nach Brahms und Wagner ein weiteres Kapitel hinzuzufügen. Wo die Werke seines drei Jahre jüngerer Freundes und Schwagers Arnold Schönberg heute zum festen Bestand des Repertoires wurden, tut man sich mit Zemlinski nach wie vor schwer: selbst die Linernotes zur vorliegenden Aufnahme der "Seejungfrau" können keine klare Linie seines Schaffens erkennen, und attestieren ihm - in einer mühsamen Formulierung, die den Vorwurf der Stillosigkeit nur knapp vermeidet - einen "langen Weg".
Aber der Reihe nach.
"Die Seejungfrau" wurde im Jahr 1905 uraufgeführt, im gleichen Jahr wie Richard Strauß' "Salome", und gemeinsam, im selben Konzert, mit Schönbergs "Pelléas und Mélisande". Im Nachhinein überrascht es außerordentlich, daß diese drei Werke wesentlich mehr verbindet, als sie trennt:
Verrückt ist, wohin die Wege danach führten.
Strauß hat noch die Elektra geschrieben, die sich in ähnlich radikalem Neuland bewegt - nur um danach einen möglicherweise noch radikaleren Schritt zu vollziehen, und mit dem "Rosenkavalier" dem konservativen Publikum zu zeigen, daß er es doch nicht so recht mit dem intellektuellen Judentum zu tun hat.
Schönberg ging bekanntlich den Weg des Revolutionärs konsequent weiter, bis hinein in die unversöhnliche Haltung eines Nicht-Verstandenen, dessen schulmeisterlicher Duktus gelegentlich groteske Werke enstehen ließ. Immerhin war er am Ende seines Lebens berühmt genug, um von seiner Lehrertätigkeit in Holywood(!) überleben zu können.

Zemlinski schließlich starb verarmt 1942 in New York. Erst in den Achtzigern begann eine Renaissance seiner Werke, immer aber unter dem Vorbehalt, es letztlich mit einem - wenn auch begabten und hörenswerten - Eklektiker zu tun zu haben.
Ich höre da etwas ganz anderes: eine jener Stimmen, die für einen ganz anderen Weg plädierten, den die Musikgeschichte nach der Tonalität hätte nehmen können, für einen Weg jenseits des kompromißlosen Einschließens in den Elfenbeinturm ebenso wie jenseits des nicht minder kompromißlosen Heranschmeißens an die gängige (bürgerliche) Vorstellung von "Kunst".
Die NS-Zeit hat diese Stimmen endgültig und unwiderruflich zum Schweigen gebracht. Wenn ich Zemlinskis "Seejungfrau" höre, habe ich jedesmal Tränen in den Augen, wenn ich mir klar mache, was uns da entrissen wurde [2].
- [1] Die Formulierung ist übertrieben apodiktisch. Alban Bergs Behandlung des Orchesters ist mindestens ebenso unwiderstehlich - von Helmut Lachenmann ganz zu schweigen.
- [2] Es steht aus: eine genauere Betrachtung der "Seejungfrau" (mir fehlen z.Zt. sowohl die Partitur, als auch eine vernünftige Aufnahme), sowie eine Besprechung der vier Streichquartette. Besonders das 4. Streichquartett op.25 (das so rätselhaft-grandios daherkommt, daß ich die Noten kaufen mußte) zeigt m.E. schlagend, daß Zemlinski einen völlig unverwechselbar eigenen Weg ging.