Der Weg in die Musik der Moderne
- 1 -
Am Dienstag, dem 8. Mai 1906 wurde an der Wiener Hofoper Wagners „Tristan” aufgeführt, Erik Schmedes ist Tristan, Anna von Mildenburg Isolde. Am Dirigentenpult: Gustav Mahler[1]. Konzertmeister: Arnold Rosé[2]. Irgendwo unter dem Stehplatzpublikum: der siebzehnjährige Adolf Hitler[3].
Arnold Rosé hatte eine Tochter mit Mahlers Schwester Jusitine, die im November dieses denkwürdigen Jahres geboren wurde und den Namen der Ehefrau Mahlers bekam, Alma. Das Leben jener Alma endete 1944: als berühmte jüdische Musikerin wurde sie von der Lageraufsicht zur Leitung der Frauenkapelle Auschwitz–Birkenau gezwungen; sie starb an den elenden hygienischen Bedingungen des KZ an Tuberkulose[4].
Von Hitler ist bekannt, daß ihm die Frauen um Winifred Wagner in den frühen zwanziger Jahren einen gesellschaftlichen Auftritt verpaßten, der aus dem ungehobelten Bewohner von Wiener Männerheimen einen auch für Reichspräsident Hindenburg akzeptablen Politiker machte[5]. Hitler bedankte sich später, und ersparte seinen Ersatzsöhnen Wieland und Wolfgang Wagner den Dienst an der Front: beide waren zu Höherem berufen, zum Dienst an der deutschen Kunst[6].
Richard Wagners Enkeln gelang es aber auch nach Ablauf der Zeit unter der Schirmherrschaft von „Onkel Wolf” ihre Stellung zu halten und auszubauen. Von Wolfgang ist allgemein bekannt, daß er bis heute Leiter der Bayreuther Festspiele ist. Ohne seinen älteren Bruder Wieland jedoch hätte sich Bayreuth schwerlich vom Erbe der Verquickung mit den Nazis erholt (zumal die Mutter – Winifred – bis zu ihrem Tod dem „Führer” treu ergeben blieb): seine Inszenierungen des „Ring”–Zyklus in den fünfziger Jahren bilden das Fundament einer Wagner–Renaissance, die bis heute fortgeschrieben wird.
Mit dabei war eine junge Sängerin, die wohl zeitweilig auch Wielands Geliebte war: Anja Silja. Ihr Name taucht in der Besetzungsliste der gestern von mir angesprochenen „Salome” auf, deren Uraufführung – und hier schließt sich der Kreis – 1905 stattfand (also gerade ein Jahr vor der denkenswerten Tristan-Aufführung, allerdings nicht in Wien, sondern in Dresden – Mahler hatte mit allen Mitteln gekämpft, die „Salome” an seiner Oper uraufführen zu können, scheiterte aber an der Habsburger Zensur).
Ich habe diese Absätze mit keiner Wertung versehen, und ich will das auch so verstanden wissen: als Auflistung von Tatsachen, sonst nichts. Ob Wieland seine Rolle in der NS-Zeit später hinterfragt und bedauert hat, habe ich nícht nachgeforscht, und die Frage ist im Zusammenhang auch völlig unerheblich – ebenso wie die Frage nach den Folgen für den Mensch und die Sängerin Anja Silja aus der Begegnung mit einem Liebling Hitlers.
Es bleibt aber festzuhalten, daß es eine Stafette gibt, die ohne Bruch von Richard Wagner selbst, über die Naziherrschaft, bis zur heutigen musikalischen Praxis führt. Das betrifft keinesfalls isoliert nur die Musik Wagners, sondern die gesamte Tradition, der sie entstammt, und die sie selber begründet. – Dazu wird noch einiges zu sagen sein.
- [1] Brigitte Hamann: Hitlers Wien. München 98, S.43.
- [2] Zu der Zeit war Rosé Konzertmeister an der Hofoper, und ich vermute nur, daß er auch bei jener Aufführung am ersten Pult saß.
- [3] Brigitte Hamann, a.a.O.
- [4] Richard Newman: Alma Rosé, eine Biographie. Bonn 2003
- [5] Wolfram Pyta: Hindenburg. München 2007 (genauer Textverweis folgt)
- [6] Brigitte Hamann: Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth. München 2003
- 2 -
Die fünfzig Jahre zwischen dem Tod Richard Wagners (1883) und der Machtergreifung Hitlers (1933) markieren einen für die Musikgeschichte des Abendlandes außerordentlich fruchtbaren und faszinierende Zeitraum - sowohl was die Zahl und Qualität der in ihm entstandenen Werke angeht, als auch in der Bedeutung, die Musik für das gesellschaftliche Leben in ihr spielte.
Es gab zahllose Komponisten, die für eine ständig wachsende Zahl von Opernhäusern und Konzertsälen die Musik zu schreiben hatten, und die in spezialisierten Schulen und Konservatorien schon in jungen Jahren eine Ausbildung erhielten, die ohne Beispiel blieb. Brahms, Strauß, Schreker, Korngold, und viele andere waren die Popstars ihrer Epoche: weltberühmt, hoch geachtet, und ebenso hoch bezahlt.
In jeder Familie der gehobenen Kreise gehörte es zum guten Ton, daß zumindest die Töchter Klavier spielen und singen konnten; daß man womöglich einen Salon unterhielt, in dem die Aufführung von Musik eine große Rolle spielte. - Es gab einen Absatzmarkt für den Ausdruck von Noten, der groß genug war, um einer ganzen Reihe von Verlagshäusern problemlos die Existenz zu ermöglichen. - Das persönliche Erscheinen in der für Jahre reservierten Loge anläßlich der Premiere der neuesten Oper war für jeden, der in „der Gesellschaft” etwas gelten wollte, verpflichtend, und zwar – zum nur hinter vorgehaltener Hand zugegebenen Leid – auch für jene, die mit Musik gar nichts anzufangen wußten.
Diese Euphorie konnte nicht einmal der erste Weltkrieg dämpfen. Selbst an dessen Ende, als auch die Zivilbevölkerung ernsthaft unter seinen Folgen zu leiden hatte, wurden mit großem Aufwand Konzerte veranstaltet und Opern uraufgeführt.
Mit anderen Worten: die Musik des Bürgertums hatte eine Bedeutung für die (gehobene) Gesellschaft, von der man sich heute überhaupt keine Begriffe mehr machen kann – trotz der heutigen Allgegenwart von Musik via Radio und CD, und trotz dem Rummel um Pop- und Rockstars.
Dabei – und darin liegt die eigentliche Pointe – muß man sich klar machen, daß es sich hier um Musik handelt, die höchsten künstlerischen Ansprüchen gerecht wird. Das wird ein wenig dadurch verschleiert, daß es nur eine recht geringe Zahl von Werken aus der Post-Wagner-Ära in das Repertoire unserer Tage geschafft hat. Wenn man sich die Mühe macht, gezielt auch bei den „kleinen Meistern” zu suchen, kommt man aber aus dem Staunen nicht heraus. Wo im Barock (auf den der Begriff der „Kleinen Meister” eigentlich gemünzt ist) der schieren Masse der Produktion ein steiles Qualitätsgefälle entspricht, scheint hier das Gesetz, daß Masse mit mangelnder Qualität einhergeht, fast außer Kraft gesetzt.
- 3 -
Wenn man Anfang und Ende jenes Weges, in dem die entscheidenden Transformationen im Verhältnis zwischen Musik und Gesellschaft vollzogen wurden, datieren will, der mit Wagner begann, und - über zahlreiche Umwege - schließlich in der Seriellen Musik nach dem Zweiten Weltkrieg mündete, ist es eine Versuchung, einen Zeitraum zwischen dem Tod Wagners (1883) und der Machtübernahme durch Hitler (1933) fünfzig Jahre später zu nennen.
Dabei gäbe es genug andere Eckpunkte, die plausibel wären. So könnte man den Beginn mit der Kaiserkrönung Wilhelms (1871) setzen, oder dem Anfang der wilhelminischen Epoche nach der Demission Bismarcks (1890), und ihr Ende auf den 8.Mai 1945 (Ende des 2.Weltkrieg). Möglicherweise kann man sogar in der gesamten Romantik eine Einheit sehen, und ihren Beginn z.B. auf das Todesjahr Beethovens (1827) legen, oder aber - aus politischer und gesellschaftlicher Perspektive - auf den Sieg in den Befreiungskriegen über Napoléon und den Beginn von Biedermeier und Restauration (1815).
Wirklich plastisch kann man die zur Debatte stehende Dialektik zwischen Musik und Gesellschaft jedoch mit zwei Ereignissen umgrenzen: der Uraufführung des "Tristan" am 10. Juni 1865 in München, und der Eröffnung der Ausstellung "Entartete Kunst" am 19. Juli 1937, in derselben Stadt.
In seiner Oper "Tristan und Isolde" legte Wagner die Keimzelle für die Auflösung der tonalen Ordnung, mit der sich die Musik des Abendlands fast drei Jahrhunderte beschäftigt hatte, und deren "Überwindung" über "Zwischenstufen" wie freier Atonalität und Zwölftontechnik, an der sich die "Serielle Musik" der fünfziger Jahre übte.
Das Ende jener tonalen Ordnung wurde nicht dadurch erreicht, daß die Musik ihren ureigenen Regungen durch die konsequente Entwicklung ihres künstlerischen Materials folgte. Vielmehr ist es die Katastrophe des Nationalsozialismus, der die romantische Musiktradition so heftig umarmte, daß sie danach unwiderruflich desavouiert war - kein Künstler, der Terror und Krieg erlebt hatte und verarbeiten mußte, konnte noch auf künstlerische Modelle zurückgreifen, die dazu gedient hatten, das Grauen beschönigend zu untermalen.
Man könnte als Endpunkt also durchaus den 30.1.1933 begreifen - die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler. Damit würde man aber all den Kontinuitäten nicht gerecht, die das Dritte Reich vorbereiteten, und die auch nach der Machtergreifung nicht einfach abgeschnitten wurden. Hindenburg wurde bereits 1925 Reichspräsident, und starb erst ein Jahr, nachdem er die Nazis endgültig installiert hatte; die Flucht der (jüdischen) Künstler aus Deutschland begann 1933 erst zögerlich, und - so wahnsinnig das auch ist - es gibt Überlieferungen zutiefst romantischer Musik, die im KZ geschrieben wurde (Viktor Ullmann hat, nach seiner Einlieferung nach Theresienstadt 1942 bis zu seiner Vergasung zwei Jahre später, zwei große Klaviersonaten geschrieben, die man später als Particell aufgefaßt und für großes Orchester eingerichtet hat).
- 4 -
Dies ist eine der berühmtesten Sequenzen der Musikgeschichte:
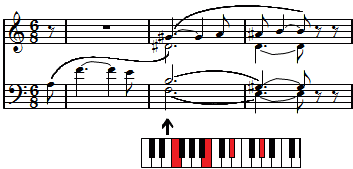
Klangzitat (Daniel Barenboim / Berliner Philharmoniker):
Der Pfeil markiert den sog. Tristan-Akkord – ein Konstrukt, das die Musikwissenschaften seit 1865 immer wieder beschäftigt hat[1]. Es gehört(e) zum guten Ton für jeden Musiktheoretiker, eine eigene Meinung zur Funktion dieses Akkords für den Zusammenhang zu haben, und zwar am besten eine, die kein anderer zuvor vertrat. Die Glaubensstreitigkeiten in diesem Fall haben sich verflüchtigt; die Wikipedia gibt den Stand der Dinge recht gut wieder. – Der entscheidende Punkt ist aber, daß man an dieser Stelle eine Debatte mit einigem Recht überhaupt führen kann.
Die Harmonik hatte sich bis zu diesem Punkt in der Musikgeschichte zur Funktionsharmonik entwickelt, in der genau eine Tonart im Zentrum einer Komposition steht, die von allen anderen Tonarten gewissermaßen umkreist wird. In C-Dur ist G-Dur die Dominante, F-Dur die Subdominante; in der Folge aus F-G-C definiert sich die C-Dur-Kadenz. Die übrigen Dreiklänge, die sich aus den Tönen der C-Dur-Tonleiter bilden lassen, können als Stellvertreter für die drei Kadenzakkorde dienen. Drei- oder gar Vierklänge, die Töne enthalten, die nicht in C-Dur vorkommen, haben noch entferntere Verwandschaftsverhälnisse zur Ausgangstonart, sind aber immer hierarchisch auf sie bezogen. – Ohne das an dieser Stelle ausufern zu lassen: entscheidend ist, daß jeder Akkord eine eindeutige (well: schon hier mindestens zweideutige) Funktion hat. Alle harmonische Entwicklung gewinnt ihre Spannung aus der Gravitation im Abstand zur Haupttonart.
Im Tristan-Akkord findet sich das erste Beispiel einer Harmonik, die mehrdeutig (besser: vieldeutig) ist – man kann von hier in verschiedene Richtungen weiter gehen; Schönbergs Analyse spricht von „vagierenden” Akkorden, die in ihrer Vieldeutigkeit als Schaltstelle für überraschende harmonische Sprünge dienen können.
So bezieht sich der Tristan-Akkord auf die Dominante von a-moll, „löst” sogar sich scheinbar in sie „auf”, so daß er den Charakter einer Zwischendominante bekommt (tatsächlich gibt es im Verlauf der Oper einige Stellen, wo die Sequenz nach a-moll bzw. A-Dur weitergeführt wird). Ebenso könnte man ihn aber auch – wenn man „dis” und „gis” enharmonisch nach „es” und „as” verwechseln darf, und das kann man hier zweifellos tun - als zweite Stufe (Stellvertreter der Subdominante) in Es-Moll deuten (was nur Theorie ist – zumindest was den „Tristan” betrifft). Dann könnte es sich aber auch um ein Konstrukt handeln, das sich wirklich jeder funktionsharmonischen Deutung entzieht, nämlich – ich weiß, das klingt jetzt etwas ausgeklinkt – um die Dominante der Vermollung der Subdominante mit hochalterierter Terz. Genau so erscheint der Akkord dann aber auch, und zwar ausgerechnet in den allerletzen Takten der Oper, nach ca. vier Stunden, für die finale Schlußwirkung – die sich dann sogar einstellt (E-Dur mit kleiner Septe geht nach H-Dur).
- [1] Ich kann mir den Hinweis auf das Notat dieser Stelle durch die zukünftige Leiterin Bayreuths nicht verkneifen.
- 5 -
Über die Vieldeutigkeit des Tristan-Akkords hatte ich bereits berichtet. Seine zweite - und vielleicht zentrale - Eigenart findet sich in der Wirkung einer sich lösenden Spannung, wenn ihm eine weitere Dissonanz folgt. In der Sequenz, in der sich der Tristanakkord in einen Dominantseptakkord bewegt, findet sich jenes Muster von Spannung-Auflösung wieder, das bis zu diesem Zeitpunkt in der Musikgeschichte dem Verhältnis von Dominante und Tonika vorbehalten war; hier hingegen erscheint die Dominate als Ruhepunkt.
In zahllosen theoretischen Untersuchungen wird immer wieder darauf hingewiesen, daß man es an dieser Stelle letztlich mit atonaler Musik zu tun hat, einer Harmonik also, die kein tonales Zentrum mehr kennt, sondern ruhelos umherirrt und in endlosen Schleifen kein Ende findet.
Der Effekt des Ungefähren, nicht wirklich zuende Geführten ist natürlich genau jener, den Wagner hier sucht, und an dem er - bis auf wenige Ausnahmen - in der gesamten Oper festhält. Eine "Kunst des Übergangs" wolle er schaffen, betont er in während des Entstehens des Werkes geschriebenen Briefen immer wieder. Tatsächlich wirken die wenigen Einschübe, in denen Dreiklänge in klaren Kadenzen erscheinen, wie Fremdkörper, fast schon, als seien sie jetzt die eigentlichen Dissonanzen. - An der Faszination über diese Wirkung hat sich seit der Uraufführung (1865) bis heute nichts geändert.
Dennoch greift es zu kurz, wenn man Wagner die alleinige Autorenschaft an diesem Umbruch zuschreibt. Bereits bei Beethoven gibt es die Tendenz, das tonale Zentrum nicht einfach als gegeben hinzustellen - und zwar klar erkennbar bereits in dessen erster Sinfonie (uraufgeführt 1800). Der erste Akkord in der langsamen Einleitung ist ein Dominantseptakkord - was heute kaum noch auffällt, wirkte auf die Zeitgenossen durchaus skandlös, wurde doch hier nicht die Tonika einfach etabliert, sondern gewissermaßen begründet. - Im Spätwerk Beethovens finden sich zahlreiche Experimente, sich im ersten Satz erst langsam und unter großen Umwegen der Haupttonart anzunähern, ein Spiel, das die Selbstverständlichkeit, mit der die Zeitgenossen diese fraglos im Zentrum - und damit am Anfang wie am Ende - erwarteten, ähnlich radikal in Frage stellte, wie Wagner dies dann später mit anderen Mitteln tut.
Aber auch die Auffassung, daß mit dem "Tristan" ein gerader Weg beginnt, der mit einer immer weiter fortschreitenden Zersetzung der Kadenz und zunehmender Entfernung vom tonalen Zentrum letztlich konsequent in der Atonalität Schönbergs und dessen Schülern endet, ist so letztlich nicht zu halten.
Damit nähere ich mich dem eigentlichen Thema, nämlich der Beschreibung jener Tendenzen in der Musik nach Wagner, die in ihrem großen Reichtum an völlig unterschiedlichen Stilistiken heute kaum noch richtig wahrgenommen werden. Zuweilen scheint es, als habe die Musik nach dem Zweiten Weltkrieg mit ihrem bedingungslosen Anknüpfen an Schönberg und Webern den Blick verstellt auf alternative, völlig anders gestrickte Entwicklungen, die Wagners Erbe mindestens ebenso konsequent hätten fortführen können wie Zwölftontechnik oder Serialismus - die freilich mit Hitlers Machtergreifung ein gewaltsames Ende fanden.
- 6 -
Der Einfluß, den das Werk Richard Wagners auf die Musik des Fin de siècle genommen hat, kann man kaum überschätzen. Das gesamte - unendlich reiche - Opernschaffen jener Jahre ist völlig undenkbar ohne ihn, und auch in der Symphonik eines Gustav Mahler hinterläßt er unübersehbare Spuren. Dabei ist es nicht nur Wagners erweitertes Verständnis der Tonalität, das hier eine Rolle spielt; auch die Klangfarben des spätromantischen Orchesters kann man auf ihn zurückführen[1]. Hinzu kommt eine Allgegenwart des Leitmotives zur Bildung von musikalischen Formen; der Gedanke, daß das Orchester zu mehr taugt, als nur die Sänger zu begleiten, sondern zum selbstständigen Protagonisten werden kann, der die Handlung auf der Bühne bis auf eine tiefenpsychologische Ebene deutet und kommentiert, wird selbstverständliches Allgemeingut im kompositorischen Werkzeugkasten.
Daneben darf man allerdings nicht vergessen, daß nach Wagners Tod für mehr als eine Dekade der berühmteste lebende Komponist seiner Zeit jemand war, den man gern als Antipoden beschreibt: Johannes Brahms. Brahms Musik stellt tatsächlich in mehr als einer Hinsicht einen Kontrast dar: das ist hauptsächlich Kammermusik, und nicht nur vom klanglichen Gestus her eben nicht für die große Bühne und zur Überwältigung des Zuhörers geschrieben, sondern rückwärts gewandt, mit Blick auf die klassischen Vorbilder. Das soll keinesfalls heißen, daß Brahms rückschrittlich sei - das Gegenteil ist der Fall, wie kein anderer als Arnold Schönberg in einem berühmten Aufsatz[2] nachweist. Brahms Technik der ständigen Variation kleinster musikalischer Bausteine zu großen formalen Gebilden ist für das Fortschreiten der kompositorischen Werkzeuge bis in die Zwölftontechnik von entscheidender Bedeutung.
Die Musik in jener Zeit findet aber nicht im Elfenbeinturm statt, zu dem allenfalls wenige Genies Zugang hatten, im Gegenteil: ihr Entstehen erklärt sich nicht zuletzt aus den sozialen Verhältnissen, in denen sie entstand. Zunächst - und das ist eine derart banale Tatsache, daß man sie gerne übersieht - gab es zu jener Zeit keine Plattenspieler. Wenn man Musik hören wollte, mußte man sie selber machen, oder sich an einen Ort begeben, wo dies andere taten.
Das hat zunächst drei Konsequenzen: zum einen gehörte es zum Bildungkanon der gehobenen gesellschaftlichen Schichten, daß ein Instrument bzw. das Singen gelernt wurde. Das galt besonders für die Ausbildung der Frauen: damit eine künftige Ehefrau und Mutter einen angemessenen Haushalt leiten konnte, mußte sie nicht nur z.B. nähen können, sondern auch das Klavierspiel beherrschen. - Zum zweiten kam dem häuslichen Musizieren eine große Bedeutung zu, und zwar sowohl im privaten Raum, wie auch in der Halböffentlichkeit der Salons. - Zum dritten waren Konzertsaal und Opernhaus von einer mit heutigen Verhältnissen nicht annähernd vergleichbaren gesellschaftlichen Bedeutung. Die Uraufführung einer neuen Oper etwa war ein Ereignis allerersten Ranges, bei der jeder zu erscheinen hatte, der im gesellschaftlichen Leben eine gewisse Rolle spielen wollte.
- [1] Man muß dabei allerdings berücksichtigen, daß Wagner hier letztlich auf Ideen zurückgreifen kann, die Hector Berlioz schon in den (18)30er Jahren entwickelte.
- [2] Brahms, der Fortschrittliche.
- 7 -
Ein Beispiel für die Bedeutung von Musik für das Leben um die Jahrhundertwende bieten die Vorgänge um die Berufung Gustav Mahlers zum Direktor der Hofoper in Wien (1897). Was heutzutage von eher untergeordneten Behörden entschieden wird, war damals ein Politikum ersten Ranges. Auf Mahlers Judentum abzielend, gab es eine großangelegte Kampagne, die diese Berufung verhindern wollte, angeführt von Cosima Wagner höchstpersönlich. Erst als Mahler zum Katholizismus konvertierte, konnte die Personalie durchsetzt werden - wobei sich noch der Kaiser selbst einschalten mußte.
Ein wichtiger Mosaikstein aus soziologischer Sicht ist die noch weitgehend ungebrochene Einheit von U- und E-Musik. Zwar kann man, anders als zu Mozarts Zeiten, deutliche Unterschiede in der Qualität von Gebrauchs- und Kunstmusik erkennen. Tatsächlich beginnt sich die Schere schon in der Mitte des 19.Jh zu öffnen, als die kammermusikalischen Werke immer anspruchsvoller werden, und schon in technischer Hinsicht von Laien kaum noch zu meistern sind: es entsteht das Genre der Salonmusik, einfache Stücke ohne größeren Anspruch sowohl in aufführungspraktischer wie auch in ästhetischer Hinsicht, für den täglichen Gebrauch geschrieben, und heute meistens vergessen. - Andererseits sind die Lieder von Schubert und Brahms als „Volkslieder” in den Alltagsgebrauch eingesickert, als „Popmusik” einer Zeit, in der die Musiker zu einem gewissen Teil noch Handwerker waren, und nicht dem permanenten Wandel der Mode zu folgen hatten. - Um dem eine weitere dialektische Wendung zu geben: seinerzeit galt das Werk Chopins als Salonmusik.
Dennoch halten die beiden Welten weitgehend zusammen. Ein Johann Strauß führt bei seinen Konzerten nicht nur die eigenen Walzer auf, sondern präsentiert mit großer Selbstverständlichkeit auch einen Ausschnitt aus einer Mahler-Sinfonie; und Richard Strauss, der mit der „Salome” 1909 eine Oper vorlegt, die definitiv zur Avantgarde zu zählen ist, verdient mit eben dieser Oper genug Geld, um fortan den Lebensstil eines reichen Mannes zu führen. Kommerz und künstlerischer Anspruch konnten noch lange Hand in Hand gehen. Daran ändert wenig, daß ausgerechnet der aus heutiger Sicht wichtigste Protagonist jener Jahre - Arnold Schönberg - hart am Existenzminimum lebte und sich mit Unterricht und Instrumentierungen für die Operette nur knapp über Wasser hielt.
Alle bislang aufgeführten Namen haben eins gemeinsam: den Ort, wo sie wirkten - die Hauptstadt von Österreich-Ungarn, der kaiserlich und königlichen Doppelmonarchie der Habsburger: Wien. Nach allem, was ich weiß, muß dies zu jener Zeit der faszinierendste Ort der Welt gewesen sein - ebenso farbig und überbordend wie zuvor das Florenz der Medici, oder vielleicht das New York unserer Tage. Den alternden Kaiser Franz-Joseph trifft man man hier neben dem heranwachsenden Adolf Hitler; Klimt, Kokoschka - und wie sie alle heißen - versammeln sich hier in einer der fruchtbarsten Zeiten für die bildende Kunst überhaupt; Grophius und das Bauhaus haben hier ihre Heimat. Dazwischen aber und damit vermischt entstehen Sinfonien und Opern, die einsame, nie zuvor und nie wieder danach erreichte Höhepunkte in der Musik des Abendlandes markieren. (Alma Mahlers Tagesbücher der Jahre 1898-1902 lesen sich wie ein Kaleidoskop des Orts zu jener Zeit.)
- Impressum
- Hosted by Manitu
- PHP-Credits
- Lizenz (CC)
