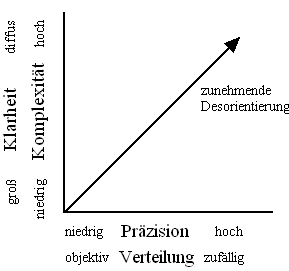Über Rhythmik
- 1 -
Musik ist bekanntlich eine Kunst, die in der Zeit organisiert ist; oder, um dasselbe anders zu formulieren, der Zeit überhaupt erst Struktur verleiht.
Die Antwort darauf, wie denn ihr zeitlicher Verlauf erfahrbar wird, liegt zunächst auf der Hand: Musik hat eine rhythmische Struktur. Nur, was ist das, Rhythmus? Die Wikipedia definiert Rhythmus als
die durch die Folge unterschiedlicher Notenwerte entstehenden Akzentmuster über dem Grundpuls.
Diese (ebenso richtige wie gleichzeitig in die Irre führende) Definition hat den Nachteil, daß sie gleich drei Begriffe einführt, die ihrerseits zunächst frei im Raum schweben: Akzent, Muster, und Grundpuls. – „Akzent” ist leicht übersetzt mit „lauter als der Rest”. Ein „Muster” ist dadurch gekennzeichnet, daß es sich wiederholt, und in seinen Wiederholungen erkennbar wird. Aber was ist der „Grundpuls”?
Ein Beispiel: [3 / 4 / 3 / 6]. Das sind die Proportionen einer typischen Abwandlung des Clave-Rhythmus, wie sie in zahllosen Pop- und Jazzrock-Stücken vorkommt. Die Frage ist bloß: was hat das mit einer Rhythmik zu tun, mit der ich brasilianische Tanzfreude assoziiere?
Ein wenig weiter komme ich, wenn ich zur konventionellen Notenschrift greife, in der Notendauern, Pausen, und Taktstriche die Struktur erklären (bitte nicht von den Noten abschrecken lassen, es bleibt auch für Notenschrift-Unkundige verständlich):
(1)
Endgültig klärt es sich, wenn ich den gemeinsamen, allen „Akzenten” zugrunde liegenden Puls mit notiere:
(2)
In der oberen Stimme sieht man vier Gruppen aus je vier Noten, die mit einem Balken verbunden sind; jeweils zwei dieser Gruppen sind durch einen Taktstrich voneinander getrennt. Jede dieser Noten hat dieselbe Dauer, und etabliert den Puls. – Im System darunter sind die „Akzente” notiert, und zwar jeweils direkt unter der dazugehörigen, den Puls repräsentierenden Note. Die erste Note „dauert” drei Puls-Noten, die nächste vier, dann drei, dann sechs - was der Zahlenreihe oben entspricht.
[(Jetzt müßte ein Klangbeispiel folgen...)]
Jene klanglichen Ereignisse, die einen Rhythmus etablieren, können nur dann erfahren und zugeordnet werden, wenn ihre Basis – in welcher Form auch immer – „erlebbar” ist. Diese Basis ist der Puls, der – wie der Herzschlag – die Zeit in gleichförmige Teile zerhackt.
Mit dieser Definition habe ich die Begriffe aus der Wikipedia (hoffentlich) eingeordnet, aber gleichzeitig ein neues Problem aufgeworfen, das erklärt werden muß (und nur um diese Hinführung geht es mir zunächst): welche Voraussetzungen braucht es, daß ich Puls „erleben” kann?
- 2 -
Musikalischer Puls wird am einfachsten erlebbar in all jenen Formen der Popmusik, in denen er von einem Schlaginstrument tatsächlich auch permanent gespielt wird (beispielsweise – meist – von der HiHat). Die gewissermaßen reinste Form findet man in jenen Stilen, die vom Computer generierte Beats benutzen (Techno, Rap – letztlich jede Popmusik seit Anfang der 90er Jahre). Hier ist der Puls nicht nur allgegenwärtig hörbar, sondern durch den Computer in völlig gleichförmige Abstände geordnet. – Ich rede hier vom „objektiven” Puls, weil die Zeitscheiben, die er vorgibt, gemessen werden können. Die Metapher des schlagenden Herzens greift hier nicht recht; jene der tickenden Uhr paßt besser.
In jenem Moment, in dem das Schlagzeug von einem Menschen gespielt wird, beginnt der Puls zu „schwimmen”. Selbst dann, wenn eine durchgeschlagene HiHat permanent hörbar bleibt, sind die Abstände zwischen ihren Achteln oder Sechzehnteln ungenau, sobald man sie objektiv vermißt. Für den Hörer macht dies zunächst kaum einen Unterschied: ein Schlagzeugcomputer ist für ihn gewöhnlich ununterscheidbar von der Performance eines professionellen Studio-Schlagzeugers. Spätestens, wenn man einen Anfänger auf dem Instrument hört, wird die Differenz jedoch deutlich. Das schwankende Tempo und den eiernden Puls nimmt auch ein eher ungeübter Hörer wahr, und beginnt im Zweifelsfall damit, sich grinsend die Ohren zuzuhalten. Der Witz ist hier jedoch, daß, aller Ungenauigkeiten zu Trotz, der Puls dennoch wahrnehmbar bleibt.
Das menschliche Ohr ist kein Scanner, der objektiv Bits zu Bytes kombiniert, und meßbare Ergebnisse liefert; statt dessen ist es ein Zuträger für das Gehirn, welches selbst zunächst ein hochwirksamer Filter ist: nur das wird durchgelassen, was gewußt und bekannt ist. – Ein an den Popgrooves unserer Tage geschultes Ohr erkennt diese selbst dann, wenn sie in verstümmelter Gestalt ankommen, etwa beim Auftritt einer Schülerband: es hört die Dinge zurecht.
- 3 -
(1)
Einen musikalischen Puls (notiert im oberen System) kann man auch dort finden, wo zwei scheinbar selbstständige rhythmische Strukturen „gegeneinander” geführt sind (im unteren System).
(2)
„Zwei gegen Drei” ist noch einfach. Aber auch „Drei gegen Vier” (im unteren System) bekommt man mit ein wenig Übung „gehört”. Das „kleinste gemeinsame Vielfache” der unterschiedlichen rhythmischen Ebenen umfaßt jetzt nicht nur zwei, sondern drei gleichförmige Zeiteinheiten (im oberen System).
(3)
Irgendwann „kippt” gewissermaßen die Fähigkeit, gegeneinander versetzte Ebenen zueinander in Bezug zu setzen – interessanterweise genau[1] dann, wenn der theoretisch zugrunde liegende Puls mehr als drei „gedachte” Schritte erfordert:
Ein „Sechs gegen Sieben” trifft sich im gemeinsamen Vielfachen einer 42tel-Ntole. Wo man schon große Erfahrung haben muß, um die Triolen im „Drei gegen Vier” wirklich wahrzunehmen, schaltet – spätestens! – hier selbst der geniale Dirigent ab, von den Musikern im Orchester ganz zu schweigen.
Im ersten Beispiel sah das noch ganz anders aus: da muß der Puls gar nicht gegenwärtig sein. Die Triolen (im oberen System) „hört” man selbst dann, wenn sie überhaupt nicht gespielt werden: man „denkt sie dazu”, wobei sie dennoch physisch erfahren und für die Sinne real werden.
- [1] Das ist nur eine persönlichen Erfahrungen – mit mir selber, und bei der Beobachtung anderer Hörer – verdankte Behauptung.
- 4 -
Musikalischer Puls muß nicht notwendig mathematisch präzise sein, um Rhythmus zu strukturieren; ein besonderes, trotzdem sehr typisches Beispiel sind „swingende” Achtel.
(1)
Das Beipiel oben ist ein Screenshot aus einem von Cubase's Editoren: im grünen Bereich ist das „Zeitlineal”, in dem jeder senkrechte Strich eine Sechzehntel markiert (die „3” in der Mitte ist die dritte Zählzeit im Takt). Die roten Rauten stehen exakt unter jedem zweiten Strich, und sind demnach präzise Achtel.
(2)
Hier ist jede zweite Achtel nach rechts verschoben, und zwar soweit, daß sie präzise auf den Triolen-Achteln liegt. – Der gehörte Puls verschiebt sich auf die Ebene der Triolen; man hört innerlich in den weißen Zwischenräumen eine weitere Note.
(3)
Im dritten Beispiel schließlich liegt das jeweils zweite Achtel (die „Off-Beats”) genau in der Mitte zwischen „Gerade” und „Triolisch”. Im Modernen Jazz ist dies die Grundfigur, die z.B auf einem Ride-Becken ständig präsent ist, und tatsächlich als kontinuierlicher Puls wahrgenommen wird. Diese Form des Pulses ist nicht mathematisch präzise, und es gibt zahllose Varianten und Zwischenstufen – man spricht vom „Swingfaktor”, wenn man ein Maß für den Grad der Verschiebung der Down- und Off-Beats zwischen „Gerade” und „Triolisch” braucht.
(4)
Im letzten Beispiel sieht man oben die „swingenden” Achtel aus Beispiel 3, darunter „gerade” Achtel, die jedoch mit den Off-Beat des Swings zusammenstoßen. In etwas übertrieben schematischer Form ist dies das, was Saxophonisten oder Gitarristen rhythmisch machen, wenn sie „cool” und „layed back” ihre Soli spielen: die Down-Beats kommen enorm spät hinter den schweren Zählzeiten der Begleitung, die Offs hingegen sind stark betont, weil sie sich mit denen der anderen decken. Dabei verschiebt sich das Empfinden für den maßgeblichen Puls nicht auf die „gerade(ren)” Achteln; dominierend bleibt weiter das „swingende” Muster.
- 5 -
Agogik heißt die Kunst, das Tempo zu verändern. Beispielsweise läßt ein Interpret die Musik immer schneller werden, um schließlich wieder abzubremsen und im ursprünglichen Tempo weiterzugehen – damit läßt sich Spannung aufbauen. Oder er wird zum Ende einer Phrase langsamer, holt gewissermaßen Atem, um mit Beginn des nächsten Abschnitts wieder das alte Tempo aufzunehmen – so bekommt ein ohnehin schon langsamer Satz besonderen Nachdruck und Schwere. Auch in kürzeren Bezügen, innerhalb eines einzelnen Taktes etwa, kann man alle möglichen Formen finden, mit denen der gleichförmige Verlauf des Tempos variiert wird.
Hier findet sich der größte Gegensatz zwischen der traditionellen abendländischen Musik und der Popmusik, gleich welcher Form. Wo aller Pop (auch der „swingende” Jazz) einem gleichförmigen Puls folgt, wird dieser in der „Klassik” ständig gebogen, beschleunigt und zerdehnt. Das heißt keinesfalls, daß es hier keinen Puls gäbe: ohne seine latente Gegenwart wäre es nicht möglich, die Abweichungen von seiner gleichmäßigen Form überhaupt wahrzunehmen.
Man kann hier aber auch eine Linie malen zwischen dem computergenerierten „objektiven” Puls bis hin zu dem völlig willkürlichen Gewackel, dem überhaupt kein Puls mehr zugeordnet werden kann. Auf dieser Linie findet sich dann z.B. der live gespielte Pop schon nicht mehr ganz auf dem extremen Pol; handgemachte Rockmusik vor der Schulung des Ohres an der „objektiven Time” der Drummachines übrigens noch ein wenig weiter entfernt davon, als heutige Livebands, die kaum noch vom Computer zu unterscheiden sind. Auf der anderen Seite des Extrems finden sich bspw. Freejazz und serielle Musik – wobei es auch im „Free”-Bereich Passagen gibt, die plötzlich einen Puls zu haben scheinen.
- 6 -
Es gibt – um das vorangegangene zusammenzufassen – zwei Ebenen, auf denen rhythmisches Empfinden stattfindet: auf der der Gleichförmigkeit (auf der „”Verteilungs"-Achse [1]) des Pulses, und jener der Klarheit, in der er dargeboten wird.

Auf der Horizontalen finden sich links „objektive Time”, und rechts „zufällige Ereignisse” – dazwischen stehen die Unterschiede zwischen einem Live-Schlagzeug und einer Drummachine, agogische Verzögerungen, oder das völlig mißratene Timing einer Schülerband.
Auf der Vertikale stehen unten einfache Achtel- oder Sechzehntel (womöglich ständig präsent auf Becken oder HiHat), oben komplexe rhythmische Verhältnisse wie ein „6 gegen 7”, aus denen ein Puls sich kaum noch oder gar nicht mehr extrahieren läßt – dazwischen einfachere Überlagerungen, wie eine „2” gegen „3”, aber auch im Grunde einfache rhythmische Figuren, in denen das Ohr sehr viele Punkte auf dem Raster des Pulses hinzudenken muß, z.B. in einem sehr langsamen Tempo, in dem dann noch nur wenige Akkorde klingen.
Die rhythmische Orientierung geht immer mehr verloren, je weiter man sich in diesem Graph nach oben oder rechts bewegt. Interessanterweise nimmt das rhythmische Empfinden überproportional ab, wenn man nach oben und gleichzeitig nach rechts geht.
Eigentlich liegt der Zusammenhang klar auf der Hand: wenn man es mit komplexen Überlagerungen zu tun hat, und der Interpret gleichzeitig mit Agogik arbeitet, wird es wesentlich schwerer, die rhythmischen Strukturen zu durchschauen, als wenn diese in computergenauer Time ausgeführt würden. Mit anderen Worte: je mehr der Puls einer rhythmische Situation verborgen ist, desto präziser muß sie ausgeführt werden, um noch zu „funktionieren”.
- [1] Die Begriffe muß ich ganz offenkundig noch gerade ziehen.
- 7 -
Es folgen einige Beispiele – zunächst, um die Extreme zu zeigen. Die Bildchen sollen den Graphen symbolisieren, wobei der rote Punkt jene Stelle markiert, an dem sich das jeweilige Beispiel findet.
(1) Maximale Aufgelöstheit
Anton Bruckner, Symphonie No.9
Es ist kaum möglich, in den ersten Takten einen Puls zu finden – da gibt es ein diffuses Tremolo, auf dem sich einige punktuelle Ereignisse abspielen, die man in kein zeitliches Raster bringen kann. Erst, wenn „es laut wird”, kann man etwas wie einen Rhythmus mehr erahnen als erkennen.
(2) Maximale Agogik
Franz Schubert, A-Dur-Sonate, Andantino, gespielt von Maurizio Pollini
Mehr an agogischer Gestaltung ist kaum möglich, ohne daß die Rhythmik „kippt”. Dabei ist im jeweils 3. Takt der viertaktigen Gruppen eine rhythmische Figur immer soweit verschleppt, daß man nur noch raten kann, wie sie wohl notiert ist. Dennoch kann man den Puls mitklopfen, weil er in den Achteln der Begleitung ständig präsent ist.
(3) Maximale Diffusion
Conlon Nancarrow, Studies for Player Piano #31
Hier findet man das andere Extrem: überhaupt keine Agogik (weil vom mechanischen Klavier dargeboten), dafür aber eine höchst komplexe Überlagerung mehrerer (dreier) Zeitebenen. Man kann natürlich keinen Puls hören – dennoch hat man an keiner Stelle das Gefühl, daß die klanglichen Ereignisse zufällig über die Zeit verteilt sind.
- 8 -
Ich habe den Graphen noch ein wenig geändert – und mich dabei gefragt, was für einen Nutzen man aus dieser Systematik[1] eigentlich ziehen kann, außer musikalische Beispiele abstrakt zu ordnen (mir ist klar, daß ich mich im Folgenden auf emotional vermintem Gelände bewege; was folgt, sind ein paar Ideen und keine abschließenden Bewertungen).
Musik auf den extremen Polen dieser Systematik ist ohne rhythmische Spannung. Die Computergrooves der Popmusik etwa sind eindimensional und ebenso automatisiert erzeugt wie automatisch durchschaubar. Sie sind – in aller Paradoxie eines im Vordergrund stehenden Schlagzeugs – letztlich ohne jeden Rhythmus. Diese Aussage gilt aber ebenso für das Theatergrollen der tremolierenden Streicher in einer Wagneroper – das hat schlicht überhaupt keine rhythmische Struktur, kein Raster also, von dem abgewichen werden könnte, wodurch dann etwas wie Spannung entstünde.
Selbst wenn diese These stimmt, kann man aus ihr keine Werturteile ableiten. Es spielt für die Qualität von Musik nicht die geringste Rolle, wo man sie in rhythmischer Hinsicht wiederfindet – selbst die Abwesenheit von Spannung mag eine ästhetisch-inhaltliche Rechtfertigung haben. – Man kann jedoch gewisse Forderungen an Notation wie Interpretation ableiten, auch ohne über „Qualität” zu befinden.
Zum einen scheint es mir wenig sinnvoll, eine Rhythmik, die derart komplex ist, daß sie letztlich mit dem Ohr nicht nachvollziehbar ist, überkomplex zu notieren. Mir fallen die Arbeiten von Brian Ferneyhough ein: sie wimmeln vor N-Tolen, die sich noch überlagern, so daß man einen Rechenschieber braucht, um heraus zu bekommen, ob sie im Taktmaß aufgehen. Selbst wenn man sie vom Computer spielen ließe, würden sie dem Ohr nicht den mindesten Sinn ergeben – bei einem Vortrag durch z.B. ein Streichquartett ganz zu schweigen. – Wohlbemerkt: ich stelle nicht das klingende Resultat in Frage. Mir kommt es aber so vor, als ob hier ein völlig überzogener Aufwand für dessen Realisierung betrieben wird.
Im Gegenzug glaube ich, daß es überall dort, wo es um komplexe rhythmische Strukturen geht, sinnvoll ist, sie so exakt wie nur irgend möglich umzusetzen. Ein gutes Beispiel wäre der letzte Satz von Mahlers „Lied von der Erde”, in dessen Partitur man zahlreiche „Vier-gegen-Drei”-Überlagerungen findet. Wenn man da noch versuchte, mit schwankendem Tempo „Ausdruck” und „Bedeutung” zu erreichen, hätte der Hörer keine Chance, eine Rhythmik zu entschlüsseln, die in ihrem Hin- und Herschwanken eine ganz entscheidende Ebene von Bedeutung transportiert: ich würde hier einen Dirigenten fordern, der stur das Tempo schlägt.
- [1] Einer Systematik übrigens, bei der ich nicht schlicht vergessen habe, die Quelle zu zitieren, sondern die, soweit mir bekannt, in diesem Blog erstmals auftaucht (womit nichts über ihren Wert gesagt wäre).
- 9 -
Was ist Groove? Was läßt Swing swingen, eine Funknummer zum Hüpfen bringen oder ein Rockstück losgehen? Was bringt einen dazu, sich zu solcher Musik fast zwangsläufig bewegen zu wollen, was bewirkt solchen motorischen Impuls und kickt direkt auf den Körper? Anders gefragt: wieso hat man beim Hören von „Klassik” das Gefühl, daß hier Harmonik und formale Organisation von großer Bedeutung sind und man ohne einen gewissen Grad an Komplexität dieser Parameter auch mangelnde Qualität leicht assoziiert – während sich dieser Eindruck bei einem Blues mit seinem ewig gleichen Schema aus drei Akkorden in zwölf Takten fast von selber verbietet?
Zunächst – und das ist nur ein Teil der Wahrheit – steht noch der simpelste Popsong auf einer Struktur aus Offbeats. Downbeats sind die schweren, Offbeats die leichten Zählzeiten, immer bezogen auf einen bestimmten Puls (s.o.). In einem Puls aus Vierteln sind »1« und »3« Downbeats, »2« und »4« Offbeats; wenn man auf die Ebene der Achtel geht, sind die Zählzeiten (1 2 3 4) „schwer” oder „down”, und die Achtel dazwischen (1+2+3+4+ – immer das „und”) „leicht” oder „off”. Das findet man dann auch auf der Ebene von halben Noten wieder: die »1« ist schwer, die »3« leicht.
Wenn man jetzt hergeht, und die eigentlich leichten Zählzeiten – eben die Offbeats – noch betont, bekommt man all jene Rhythmen, die im Popbereich eine Rolle spielen.
Man kann wohl soweit gehen und sagen, daß sich all die unterschiedlichen Stile, die man in der Popmusik findet, letztlich durch die Art und Weise unterscheiden, in der sie Offbeats betonen. Einen Swing – oder auch nur dessen Zitat – erkennt man an der Betonung von »2+« und »3+« durch das Becken (dieses „ding-diggeding” des Ride). Einen Reggae identifiziert man über die Bassdrum auf der »3« und Offbeats auf »2« und »4« von der Gitarre; selbst dann, wenn man andere Zutaten wegläßt – wie die typischen Gitarrensounds oder jene Baßbegleitung, in der es keine »1« mehr gibt – bekommt man immerhin eine Ahnung davon. Disco: das ist eine auf allen Vierteln durchlaufende Bassdrum, die die Offbeatwirkung der Snare (auf »2« und »4«) stark zurücknimmt. – Und so weiter.
Mir ist an dieser Stelle nicht um die Vollständigkeit der Liste zu tun; ich will nur herausstellen, wie wichtig die Betonung der Offbeats für alle Popmusik ist – von Blues bis Indie, von Rock'n Roll bis Trance, aber auch für Volksmusik und Jazz, sogar – auf versteckter Weise – für dessen Experimente im Freejazz.
Dabei gibt es natürlich auch in der abendländischen Kunstmusik Werke, die die leichten Zählzeiten betonen; Adorno hat die angebliche Überlegenheit des Jazz in rhythmischer Hinsicht – fast höhnisch knapp, aber mit einigem Recht – mit Verweis auf Johannes Brahms zurückgewiesen. – Tatsächlich findet man letztlich für jedes Experiment der Pop- oder Jazz-Avantgarde ein Gegenstück in der „Klassik”, das sich des jeweiligen Themas konsequenter und radikaler annimmt, ob es sich um Form oder Harmonik handelt, oder auch um scheinbar popimmanente Bereiche wie Sound oder Rhythmik.
Durch diese Feststellung (Behauptung?) ist die Frage nach dem Wert bestimmter Musik natürlich noch längst nicht beantwortet – ja, sie wurde dadurch nicht einmal gestellt.
- 10 -
Mein Rekurs auf die Bedeutung des Offbeats für die Rhythmik im Popbereich ist verkürzt, und bietet in dieser Verkürzung letztlich keine Erklärung: sonst könnte man nämlich Computer so programmieren, daß sie „am Grooven sind” – und in dieser Hinsicht – und ich sage das bewußt so ungeschützt und apodiktisch – sind alle Versuche gescheitert. – Dafür sehe ich wesentlich zwei Gründe:
Zunächst ist es nicht so, daß es einfach nur „den” Puls gibt, aus dem sich dann eine für eine bestimmte Stilistik gültige Offbeat-Charakteristik ablesen ließe.
- Es finden immer mehrere Ebenen – die der Halben, Viertel, und Achtel (Sechzehntel?!) – gleichzeitig statt und sind ineinander verzahnt – wenn etwa die „2” und „4” betont werden, sind gleichzeitig die Achtel mit eigenen Offbeats eingebettet oder kontrastieren dazu.
- Die Offbeats sind nicht gleich viel „wert”; in der Reinform des Swing sind z.B. die Offbeats auf „2+” und „4+” betont, jene auf „1+” und „3+” kommen im Schlagzeug gar nicht vor. In anderen Stilistiken mag es sein, daß ein unregelmäßiges Auf und Ab in den Lautstärken eine Rolle spielt, wo dann nur noch die relativen Unterschiede zwischen Off- und Downbeats ins Gewicht fallen.
- Eine große Rolle spielt, ob und wo die „1” betont ist. Es gibt Grooves, die völlig ohne „1” auskommen (Reggae); für andere ist es essentiell, daß sie als Gegenpol zu den Offbeats deutlich hör- und spürbar ist. – Usf.
Dies ist – mehr oder weniger – die Ebene der Organisation der Lautstärke einzelner rhythmischer Impulse. Wenn man versucht, sie mit einem Computerprogramm nachzustellen, läuft man zwar in zahllose komplexe Probleme, hat letztlich aber keine unlösbare Aufgabe vor sich.
Anders sieht es aus, wenn man sich auf die Ebene der Microgrooves begibt, wie ich dies nenne.
Selbst jene Musiker, die rhythmisch außerordentlich präzise „den Punkt treffen”, sind dies nicht in maschinenhafter – „objektiver” – Art und Weise. Es gibt immer ein winziges Schwanken, selbst wenn sie versuchen, es zu vermeiden – und ein Musiker, der die Bude zum Tanzen bringen will, wird den Teufel tun, diese Schwäche im Vergleich zur Maschine zu verstecken, ganz im Gegenteil: so wie ein Roboter nicht tanzen kann, sondern sich – allenfalls – als Imitat eines Menschen bewegt, produziert ein Musikprogramm vielleicht den faden Abglanz eines gut gespielten Schlagzeugs, aber kaum das reale Bild eines Drummers, der kontrolliert darauf losdrischt.
Da gibt es z.B. den Begriff des „lay back”, mit dem man den Eindruck beschreibt, daß ein Saxophon unglaublich lässig „hinter” dem Beat hängt, und den Drummer dazu zu verführen scheint, immer langsamer zu werden. Ebenso gibt es das Gegenteil, die nach vorne gelehnte Figur im Becken, die immer schneller werden will. Dann gibt es den Effekt, daß innerhalb einer – vier- oder achttaktigen – Phrase das Tempo anzuziehen scheint, um mit ihrem Ende in sich zusammenzubrechen und Luft zu holen. Und so weiter, es gibt zahllose solcher Beispiel, die immer eines gemeinsam haben: sie entfernen sich vom „objektiven” Puls – und die Regeln, nach denen sie dies tun, entziehen sich bislang – letztlich? – jedes Verstehens.
- 11 -
Ani DiFrancos Gitarre und das Schlagzeug Andi Stochanskys bilden das Rückgrat der Musik DiFrancos der Jahre 1990-97, so auch auf dem Album "Dilate". In zwei Stücken werden hier jedoch Drumloops bzw. Drum-Sequencing eingesetzt – mit der Folge, daß, trotz aller Gitarrenarbeit, die Ebene der Rhythmik sehr viel flacher wirkt. Das klingt, als habe man da eine schwer bestimmbare Dimension weggenommen, oder als bräche plötzlich alle Räumlichkeit in sich zusammen. Beim direkten Aufeinandertreffen von Live-Grooves mit jenen aus dem Computer kann man diesen Effekt recht gut nachvollziehen.
Zunächst wäre jedoch festzuhalten, daß sich das Bewußtsein über diese Differenz bei relativ wenigen Hörern hält. Es wäre leicht, der Versuchung nachzugeben und dem Mainstream mit seiner seit mehr als zwanzig Jahren ununterbrochenen Produktion von maschinengesteuerten Drumsequenzen dafür die Schuld in die Schuhe zu schieben, und anzunehmen, daß dies davor besser war. Ich weiß nicht, ob dies so ist – zumindest kann man immer noch und immer wieder Hörer finden, die intuitiv solche „Computermusik” ablehnen, und Musiker, die auch im Studio darauf insistieren, daß ihre Songs „von Hand” eingespielt werden.
In der Entwicklung der Musiksoftware spiegelt sich dies insofern wieder, als man einige Versuche unternommen hat, den Usern Möglichkeiten zum Aufweichen der „objektiven Time” in die Hand zu geben. (Ich verwende in der Folge den Begriff „Raster”, wenn ich mich auf den Puls in „objektiver Time” beziehe.)
- Ganz am Anfang – bereits in den Hardware-Sequenzern Mitte der Achtziger – steht die Option, über Tempowechsel und -verläufe zu verfügen. Damit wäre es z.B. möglich, den Spannungsverlauf einer über einen vom Sequenzer generierten Background laufenden Improvisation dadurch zu unterstützen, indem man das Tempo nach und nach steigert – wobei man diese Anwendung in der Praxis kaum einmal findet.
- Eine Funktion, die heute in keinem Sequenzer fehlt, ist ein einstellbarer „Swingfaktor”, mit dem man gerade Achtel zu triolischen Achtel und allen Stufen dazwischen verschieben kann. Das klingt noch lange nicht nach Swing, allenfalls nach dessen eigenartig verzerrtem Abbild – man beläßt es in der Regel auch bei hart quantisierten Achteln.
- Eine weitere Möglichkeit findet man mit verschiedenen Verfahren, zufällige Abweichungen von der Quantisierung zu generieren. Man kann dann z.B. alle Achtel der HiHat um ein einstellbares Maximum zufällig um das Raster „pendeln” lassen.
Es gibt eine Reihe unterschiedlicher Möglichkeiten, auf dem Keyboard eingespieltes Material nachträglich zu quantisieren.
- „Hartes” Quantisieren hat immerhin den Vorteil, daß die ursprünglichen Lautstärken der Noten erhalten bleiben – damit bleibt von der Live-Performance wenigstens die Ebene der (Offbeat-)Betonungen erhalten.
- Beim „iterativen” Quantisieren werden die Noten nicht gewissermaßen auf dem Raster festgenagelt, sondern ihm nur angenähert; der User kann Vorgaben machen, in welchem Grad dies geschieht. Das setzt aber voraus, daß die zugrunde liegende Aufnahme tendenziell stimmig ist – man muß schon recht gut spielen können, um mit diesem Feature befriedigende Resultate zu bekommen.
- Schließlich gibt es eine ganze Reihe von Versuchen mit sog. „Groove-Quantize”. Dabei werden die Aufnahmen von Profidrummern darauf analysiert, wo dort vom objektiven Raster abgewichen wird. Dabei versucht man gar nicht erst, etwas wie ein Regelwerk zu finden, das man als Ausgangspunkt für algorithmische Lösungsverfahren benutzen könnte. Statt dessen baut man Bibliotheken aus solchen Groove-Rastern, indem man zahlreiche konkrete Aufnahmen analysiert – der User hat hinterher die Auswahl.
- In diesem Zusammenhang ist eine Technik erwähnenswert, mit der sich eine Schlagzeugaufnahme in einzelne „Slices” zerlegen läßt. Dabei wird eine Audiodatei nach „Peaks” durchsucht, welche sich durch unterschiedlich hohe Pegel den verschiedenen Instrumenten eines Drumsets zuordnen lassen. Auf diese Weise kann auch der User recht einfach neue Groove-Raster finden und seiner Bibliothek hinzufügen.
- Impressum
- Hosted by Manitu
- PHP-Credits
- Lizenz (CC)