Der Mythos der Vier-Oktaven-Stimme
Wenn man einen Sänger besonders loben möchte, sagt man gern, er habe eine Vier-Oktaven-Stimme - das klingt deshalb so schön, weil der, der das sagt, ein Fachwort wie „Oktave” im Munde führt, was ihn per se als Fachmann ausweist. Mit einem anerkennenden Nicken ausgesprochen, wird die „Vier” dann auch zu einer richtig großen Zahl, und alle, die sie hören, sind angemessen beeindruckt und nicken wissend zurück.
Das „dreigestrichene C” ist die höchste Note, die man von einem dramatischen Sopran wie jenem Waltraud Meiers zu hören bekommt. Wenn es richtig tief wird, muß ein Alt herunter in die „kleine” Oktave; noch tiefere Noten als das „kleine D” habe ich noch von keiner Frauenstimme gehört (in einer Aufnahme Waltraud Meiers von Schuberts „Tod&das Mädchen”). Dieser Umfang sieht dann so aus:
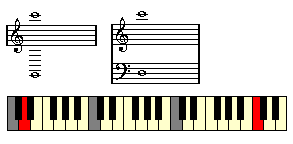
Damit ist man bei einem Tonumfang von nicht einmal drei Oktaven, und der ist selbst für Opernsänger das äußerste Extrem[1].
Wenn jemand Fachvokabular in Kombination mit Zahlen verwendet, sollte man davon ausgehen, daß sich jemand schrecklich wichtig machen will, und selber nachzählen. Das gilt ausdrücklich nicht nur für den Bereich der Musik.
- [1] In der Opernliteratur ist das „kleine A” in der „Salome” der tiefste mir bekannte notierte Ton für einen Sopran. Die „Königin der Nacht” muß bis hinauf zum „dreigestrichenen F” - dafür ist es das Privileg eines Koloratursoprans, nicht ganz so arg in die Tiefe hinab zu müssen.