Improvisation in der Musik
Interpretation und Improvisation
Wenn man heutzutage über improvisierte Musik spricht, meint man fast immer und in allererster Linie die Improvisationen im Jazz. Im klassischen Bereich ist die Fähigkeit zum „Musizieren ohne Noten” mehr oder weniger vollständig verschwunden - aber auch im Pop oder Rock findet man immer seltener z.B. einen Gitarristen, der in einem bestimmten Solo nicht stets dieselben, vorher festgelegten Phrasen spielt, sondern jedesmal etwas Neues aus dem Stegreif erfindet.
Dabei hat die Kunst, spontan Musik erst beim Spielen entstehen zu lassen, eine ehrwürdige Tradition. Ich denke z.B. an die Geschichte der Begegnung von Friedrich dem Großen mit J.S.Bach, als Bach nach einem Thema Friedrichs eine Fuge improvisierte, und erst scheiterte, als ihm eine sechstimmige Polyphonie abverlangt wurde (daraus wurde dann das „Musikalische Opfer”). Ich denke auch an all die Wettkämpfe zwischen Musikern in adligen und bürgerlichen Salons, bei denen es stets auch um die Frage ging, wer am geschicktesten über vorgegebene Themen „phantasieren” kann.
Auch in der Aufführungspraxis des Barock gibt es einen starken improvisatorischen Anteil: das Basso Continuo wurde lediglich als Generalbaß notiert, als Baßstimme also, der lediglich Ziffern beigegeben sind, aus denen sich die Akkorde ergeben - der Cembalo-, Orgel- oder Lautenspieler mußte den Rest spontan selber hinzutun. Diese Praxis ist heute wohl ausgestorben; der Generalbaß wird üblicherweise durch ein vorab ausgeführtes Notat ersetzt. Ähnliches gilt für die Ornamente und Verzierungen, die in der Barockmusik dem Geschmack und dem Können der Musiker überlassen waren und über weite Strecken nicht einmal andeutungsweise notiert waren. Auch hier wird in den modernen Editionen noch jeder Triller vorgeschrieben (auch wenn man in den Fußnoten vermerkt, daß sie im Original fehlen).
In der Rockmusik der späten 60er und 70er Jahre bekam das improvisierte Solo eine gewichtige Rolle, was nicht zuletzt daran lag, daß man Improvisation mit Begriffen wie „Spontanität” und „Freiheit” assoziierte, die bekanntlich in dieser Epoche außerordentlich positiv konnotiert waren. Bei einer Band wie »Grateful Dead« führte das soweit, daß der Anteil der Soli zuweilen derart überwog, daß der Sänger kaum richtig zu tun hatte - wobei der ja nicht nur zu singen hatte, sondern zudem noch Gitarre spielte. Andere Beispiele lassen sich leicht finden.
All diese improvisatorische Praxis ist heutzutage weitgehend ausgestorben - einzig im Jazz spielt sie noch eine Rolle. Viele klassisch ausgebildete Musiker, denen ich begegnet bin, waren in Gesprächen immer wieder fasziniert davon, daß man sich an sein Instrument begeben und einfach drauf los spielen kann, eine Fähigkeit, die sie sich nicht erklären konnten. Dabei ist das Thema nicht ganz so simpel: jeder Musiker improvisiert, und zwar auch dann, wenn er strikt einem Notat folgt. Auch ein Jazzmusiker bewegt sich keineswegs einfach bloß frei und spontan, sondern folgt einem beachtlichen Satz an Regeln und Konventionen.
„Klassische” Musiker, die vom Notenblatt ablesen, sind keinesfalls tumbe Replikatoren einer so und nicht anders ausführbaren Spielanweisung. Gerade die Notenschrift ist hochgradig ungenau und allenfalls eine grobe Annäherung an das, was schließlich auf ihrer Grundlage an Musik entsteht: man muß sie interpretieren. „Interpretation” und „Improvisation” sind Begriffe, die keinesfalls grundsätzlich unterschiedliche Dinge beschreiben; eher sind sie zwei Seiten derselben Medaille. Der Interpret fügt individuelle Aspekte hinzu, wie auch der improvisierende Musiker nicht im luftleeren Raum schwebt und jeden Punkt seiner Darbietung aus dem Moment erschafft. - Aber eins nach dem anderen.
Interpretation betrifft nicht nur Fragen der technischen Ausführung, wie z.B. Wahl des Fingersatzes oder das Festlegen von Atempausen, sondern berührt Aspekte, die den ganz elementaren Charakter des vorzutragenden Stückes berühren. Das ist nicht nur die - freilich grundlegende - Auswahl des Tempos, sondern auch die Gestaltung von Lautstärke, Phrasierung und Agogik. Letztlich bekommt eine Komposition ihren Sinn erst durch die kreative Arbeit des Interpreten: ohne seine Analyse einer Partitur und den Schlüssen, die er daraus zieht, gibt es keine klingende Musik, die einer nachvollziehbaren Logik folgt.
Dabei finden sich unterschiedliche Abstufungen, wenn es um „Individualität” oder „Spontanität” geht. Auf der einen Seite stünde dort jener, der ein Stück zum ersten Mal sieht und es „vom Blatt” spielt (wie man sagt). Im anderen Extrem findet sich der Geiger am sechsten Pult der ersten Geigen eines Sinfonieorchesters, dem in aufwendigen Proben noch jene Freiheit genommen wurde, den Bogenstrich selbst zu wählen: alle ersten Geigen spielen Auf- und Abstriche völlig synchron. Seine ausgedruckten Stimmen wird der Notenwart nach all diesen Proben mit aberhundert handschriftlichen Ergänzungen zurück bekommen, in denen nicht nur Zusätze zu dynamischen Verläufen oder eben Stricharten festgehalten wurden, sondern teilweise sogar Fingersätze vermerkt sind, die er - wie alles andere auch - so und nicht anders auszuführen hat. - Zwischen diesen Extremen findet sich etwa ein Virtuose an einem bestimmten Instrument, der seine Interpretation zwar völlig frei und individuell gestaltet, sie jedoch - nachdem er sich ein Stück „erarbeitet” hat - immer wieder nahezu identisch vorträgt.
Eine entscheidende Rolle in improvisierter Musik spielt die Fähigkeit des „aufeinander Hörens” (ich komme ausführlich darauf zurück) - auch hier gibt es letztlich allenfalls einen graduellen Unterschied zum Musiker, der einen Notentext interpretiert. In einem Streichquartett oder Klaviertrio kann man noch so genau und präzise seinen Part replizieren - ohne präzises Ohr für den Mitmusiker läuft das binnen kurzem auseinander. Die besten kammermusikalischen Ensembles sind jene, in denen die Individuen zu verschwinden scheinen und man das Gefühl hat, es mit einem einzigen Instrument zu tun zu haben. Solch ein Eindruck entsteht nicht deshalb, weil die Individuen de facto verschwinden (wie sollte das auch gehen?), sondern weil diese akkurat nach- und mitvollziehen (gar vorvollziehen), was die Mitspieler tun.
In der Gestalt des Dirigenten gibt die letzte Variante eines Diktators, den man heute in den westlichen Gesellschaften toleriert (oder gar verehrt). Seine Macht über ein Orchester beschränkt sich aber letztlich auf die Proben - nur dort kann er seine Sicht der Dinge erklären und dafür sorgen, daß man seinen Vorstellungen folgt. Im Konzert ist er dann gelegentlich arg am Tanzen und will mit großen Gesten dem Publikum suggerieren, daß er der Star sei - dabei sind es auch hier die aufeinander hörenden Musiker, die den Zusammenhalt bewirken. Es ist kein Zufall, daß man gerade in den rhythmisch gelegentlich überaus komplexen Werken der Neuen Musik oft einen Dirigenten findet, der mit sparsamen Bewegungen mehr oder weniger ein Metronom ersetzt - die Tänze sind dort nur möglich, wo es ihrer nicht bedarf und man sich darauf verlassen kann, daß die beteiligten Ohren gründlich vernetzt sind und spontan aufeinander reagieren.
Jazz - Modal vs. Free
Die Begriffe „Jazz” und „Improvisation” werden gelegentlich nahezu synonym verwendet. Dabei gibt es auch im Jazz immer Einschränkungen für die Freiheiten der Musiker – und zwar sowohl, was das Material angeht, mit dem improvisiert werden kann, als auch im Grad, in dem die Mitglieder eines Ensembles in der Ausgestaltung ihrer Rolle „frei” sind.
Auf den ersten Punkt komme ich später zu sprechen; für den zweiten gibt es wiederum zwei verschiedene Aspekt. Zum einen gibt es fast immer zumindest einen auskomponierten Kern – ein Thema, eine ständig wiederholte Akkordfolge, oder Riffs und Einwürfe während eines Solos. Zum anderen gibt es Unterschiede im Verständnis der Rolle der Begleitung: in manchen Stilen wird auch hier improvisiert, während sie in anderen auf bestimmte Patterns und Figuren mehr oder weniger festgelegt ist.
Vergleichsweise gering ist die Freiheit selbst für einen Solisten in der Bigband, und zwar unabhängig vom Stil. Hier überwiegen nicht nur komplett auskomponierte Passagen, sondern auch in den Soli gibt es einen klar fixierten Rahmen, der z.B. deren Länge festlegt und mit eingeschobenen „Riffs” und „Compings” die Möglichkeiten ihrer freien Gestaltung noch weiter einschränkt.
In den kleinen Besetzungen bewegen sich die Solisten idR wesentlich freier – der Mißmut der Musiker in den Orchestern des späten Swing gegen den überaus starren Rahmen führte dazu, die großen Besetzungen zu verlassen, und in den Jam–Sessions der Nachkriegszeit Saxophon und Trompete Freiräume zu verschaffen, in der zumindest die Länge des Solos vorher nicht mehr festgelegt sind. Auch im Bebop der späten 40er und 50er Jahre ist es jedoch üblich, daß über einen weitgehend starren Background improvisiert wird. Es gibt zwar eine Reihe von neuen Möglichkeiten für den Drummer, wobei seine Grooves aber im großen und ganzen weiterhin auf einer konstanten Figur von Becken und HiHat basieren. Der Bassist liefert einen konstanten Teppich aus Viertel–Noten, und das Piano markiert die Akkorde.

Miles Davis
Dieses Muster ändert sich erst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre grundlegend, nicht zuletzt im legendären Quintett von Miles Davis. Hier ist das Schlagzeug von Tony Williams völlig gleichgestellt und emanzipiert sich von der Rolle des Lieferanten eines rhythmischen Hintergrunds – es wird zum gleichberechtigten „Gesprächspartner”. Gelegentlich dreht sich das Verhältnis zwischen Begleitung und Solo sogar komplett um, und die Bläser begleiten letztlich nur noch die Rhythmusgruppe (ein schönes Beispiel findet sich auf dem Titelsong des Albums „Nefertiti”: die Bläser wiederholen wieder und wieder das Thema, während sich Herbie Hancock und Tony Williams gründlich austoben).
Das letzte Extrem findet man schließlich in den Experimenten des Free–Jazz, in dem alle Mitglieder einer Band absolut gleichberechtigt sind, und die Trennung zwischen Begleitung und Solo aufgehoben wird: jeder ist ständig am improvisieren, und jeder kann die Initiative übernehmen und die Performance in eine neue Richtung bewegen. Interessanterweise findet man das Wechselspiel zwischen Größe der Besetzung und Grad der Freiheit bei den Improvisationen auch in der sog. „Freien Musik” wieder: Großbesetzungen müssen zwangsläufig wesentlich mehr mit vorgegebenen Strukturen arbeiten als kleine Gruppierungen, damit es nicht zum schierem Chaos kommt. Bei letzteren ist es sehr viel eher möglich, Struktur zu erzielen, indem die Musiker einander zuhören und auf das Spiel des anderen spontan reagieren.
Der improvisatorische Freiraum wird nicht nur durch auskomponierte Passagen eingeschränkt und in vorgegebene Bahnen gelenkt, sondern auch durch das musikalische Material, das der jeweiligen Stilistik zugrunde liegt. Auch hier gibt es wieder zwei Aspekte: zum einen ist ein Musiker schlicht durch sein Training fixiert - was er vorher fest in die Finger „einprogrammiert” hat und schließlich nur noch wörtlich abrufen kann, wird man kaum als spontane Improvisation bezeichnen können (ich vertage diesen Punkt auf später).
Zum zweiten finden sich in jeder Stilistik gewisse Barrieren, die nicht ohne weiteres überschritten werden können. Im Swing wird man kaum damit rechnen, daß ein Saxophon plötzlich „free” spielt - solange es keinen völlig neuen Stil erfinden will, wird es sich an die vorgegebenen Akkorde halten - und sich nicht einmal in den äußersten Spannungsbereichen der "upper tensions" bewegen, für die erst der Modern Jazz der 60er und 70er zuständig ist. Das Gerüst aus musikalischem Material, auf dem eine Improvisation aufsetzt, kann dabei mehr oder weniger enge Grenzen setzen, wobei selbst im Free-Jazz bestimmte Konventionen bestehen, die nicht ohne Grund verletzt werden können.
Die Basis der allermeisten Stile bildet ein Cantus firmus (wie man im Barock sagen würde) aus ständig wiederholten Akkorden, den sog. Changes. Es gibt einige populäre Formmodelle, den 12-taktigen Blues oder die 32-taktige AABA-Form etwa; es finden sich aber im Modern Jazz auch Changes mit ungeraden Taktzahlen. Dabei variiert die Komplexität der Akkordfolgen über eine große Bandbreite. Der Blues mit seinen drei Akkorden wird auf der einen Seite noch untertroffen durch modale Strukturen, die sich mit einem einzigen Akkord begnügen und z.B. auf einem ständig wiederholten Basslauf basieren. Am anderen Ende der Skala finden sich Stücke im Up-Tempo, in denen pro Takt zwei Akkorde folgen, die zudem wild durch alle Tonarten modulieren.

John Coltrane
Dabei leuchtet ein, daß über einfache Strukturen nicht nur einfacher zu improvisieren ist, sondern daß sie auch wesentlich größere Freiräume bieten. In der erwähnten Up-Tempo-Nummer ist der Solist letztlich mehr damit beschäftigt, den formalen Vorgaben zu folgen, als eigene Ideen spontan zu entwickeln (umso mehr staunt man dann, wenn John Coltrane über das klassische Beispiel eines solchen Stückes - „Giant Steps” - über Minuten die Ideen nicht ausgehen wollen). Hingegen bedeutet eine „modale Fläche” - selbst in einem flotten Tempo -, daß der Solist sich alle Zeit der Welt nehmen kann, und in großer Ruhe seine Improvisation entwickeln kann.
Man findet hier eine Begründung für das Paradox, daß Jazzrock und Freejazz nahezu zeitgleich entstanden, und zudem in ihrer Entwicklung von Musikern vorangetrieben wurden, die sich kurz zuvor noch eine gemeinsame Bühne teilten. Paradigmatisch wären das John Coltrane mit „Ascension” (1965), und Miles Davis mit „Bitches Brew” (1970). Beide Musiker kommen letztlich aus der Tradition des Bebop (wenn man zwei im Grunde diametral unterschiedliche Philosophien ausnahmsweise unter ein gemeinsames Schlagwort zusammen fassen darf), und beide versuchen, sich von den Fesseln zu befreien, die ihnen diese Tradition beschert.
Die Folgerungen ergeben beträchtlich voneinander abweichende musikalische Ergebnisse - gemeinsam ist ihnen aber ein ganz erheblich erweiterter Spielraum für improvisatorische Spontanität.
Pattern-Spieler

Die oben stehende Phrase (man muß die Noten nicht lesen können, um das Folgende zu verstehen) bildet die ersten Takte in der Charlie-Parker-Nummer „Donna Lee”. Jeder E-Bassist, der sein Instrument im Jazz einsetzt, wird sie kennen und wahrscheinlich auch (in „Up Tempo” - also schnell) spielen können - Jaco Pastorius beginnt mit diesem Stück sein Soloalbum (1976), das so etwas wie den heiligen Gral für all jene E-Bassisten darstellt, die versuchen, in seine Stapfen zu treten.
Umso überraschter war ich, als ich während meines Studiums ziemlich jedes jemals aufgenommene Solo von Charlie Parker zu hören bekam, und mehr als einmal (ich kann die genaue Zahl nicht mehr erinnern) exakt diese Phrase in jeweils anderen Zusammenhängen auftauchte. Tatsächlich handelt es sich bei „Donna Lee” im Grunde um ein notiertes Parker-Solo über eine recht gängige Akkordfolge - und es stellte sich heraus, daß Parker ein Pattern-Spieler war.
Kein Musiker erfindet während der Improvisation völlig neue Dinge, Sachen etwa, die er nie zuvor gespielt hat. All das Material, das ihm zur Verfügung steht, hat er sich zuvor mehr oder weniger hart erarbeitet. Das gilt selbst für die Geräusch- und Klapperorgien im ganz harten Freejazz, wo die Musiker gelegentlich ihre Instrumente in ihre Bestandteile zerlegen, diese hinterher untereinander tauschten, um damit auf ein Becken zu hauen oder mit dem Mundstück des Saxophons zu quietschen: selbst das ist mehr oder weniger im Vorfeld erkundet und erprobt.
Dabei macht es aber schon einen Unterschied, ob jemand mehrtaktige Phrasen, die über komplette Akkordfolgen gehen, einübt und hinterher wörtlich immer wieder verwendet, oder ob bestimmte Akkordbrechungen oder Skalenläufe geübt werden, die sich dann in der Improvisation zu immer neuen Gebilden miteinander verknoten lassen. Pattern-Spieler sind notorisch nicht nur für ein eher begrenztes Repertoire an neuen Formeln, sondern auch für ihre Neigung, ihre Phrasen auch dort abzuspulen, wo sie überhaupt nicht passen - über Akkordfolgen etwa, für die sie keine vorgefertigten Versatzstücke in Petto haben.
Insofern war es keine schlechte Überraschung, hier ausgerechnet einer legendären Gestalt wie Charlie Parker auf die Schliche zu kommen. (OK, ganz so dramatisch ist das wohl nicht, hat doch fast jeder Solist zumindest die eine oder andere längere Phrase auswendig gelernt, die er dann - neben anderem - gelegentlich einwirft.)
Die Alternative besteht darin, sich mit dem harmonischen Material auf grundsätzliche Weise zu nähern: man lernt, die Akkorde in einzelne Töne zu „brechen” und die zu ihnen gehörenden Tonleiter - „Skalen” - zu spielen. Es gibt eine verbreitete Theorie, mit der man die „Changes” funktionsharmonisch deuten und ihnen anhand ihrer Funktion eine Skala zuordnen kann - sie stammt von der „Berkley School of Jazz” und hat sich weitgehend etabliert. (Dazu gehört natürlich, daß sich von dieser Theorie zahllose Varianten und Untervarianten gebildet haben, deren Vertreter gelegentlich äußerst gereizt miteinander umgehen, wenn es um Fragen geht wie jene, ob in einem G9-Akkord die Septe schon enthalten ist oder nicht.)
Schüler und Studenten lernen zunächst, diese Skalen zu spielen - und weil es davon eine ganze Menge gibt, sind sie damit die nächsten Jahre gut beschäftigt. In einem typischen Vorspiel an einer Musikschule finden sich dann immer wieder Improvisationsversuche, bei denen eine Skala an die andere gereiht wird - und weil man die ja immer von Grundton zu Grundton geübt hat, hakt es bei jedem Taktwechsel, wo der nächste Akkord und damit die nächste Skala folgt. Man kann schon von Glück reden, wenn die nächste Nummer modal ist und die Schüler sich auf nur eine Skala beschränken können - und wo sie dann auch kein Problem haben, sie immer komplett von unten nach oben zu spielen.
Skalen
Die Kenntnis der zu einem Akkord gehörigen Skala kann nicht schaden - sie hilft aber letztlich nicht dabei, sinnvolle Linien über eine Akkordfortschreitung zu finden. Ganz schlimm wird es, wenn man eine Folge von Akkorden darauf untersucht, worin ihr kleinster gemeinsamer Nenner besteht, nach dem Moto: über diese vier Takte könne man immer die C-Dur-Skala spielen. Es gibt keinen Könner, der so denkt, und wenn man im Unterricht trotzdem solche Modelle vermittelt, tut man seinen Schülern letztlich keinen Gefallen – das Ignorieren der Wechsel zwischen den Akkorden schafft sie nicht aus der Welt, und das Ergebnis solcher Improvisationen klingt zwangsläufig zum Weglaufen. Wenn man schon über Changes spielen will, muß man sie auch ernst nehmen, und zwar nicht nur jeden Akkord für sich, sondern den Spannungsverlauf der kompletten Folge.
Dabei macht man zuerst die Entdeckung, daß die unterschiedlichen Töne, aus denen ein Akkord aufgebaut ist, auch in einem unterschiedlichen Grad an Spannung zu ihm stehen. Grundton und Quinte etwa bilden das spannungslose Gerüst, Terz und Septe geben die Farbe. Die None hat eine ganz eigene Charakteristik, die – als Quinte über der Quinte – keine rechte dissonante Wirkung hat, obwohl sie zu den „Tensions” gehört. „11” und „13” schließlich sind echte Spannungstöne. Dann gibt es - je nach Funktion eines Akkords – unterschiedliche Möglichkeiten der Alteration: ein Dominantseptakkord bietet zahlreiche Möglichkeiten, Quinte, None, „11” und „13” hoch bzw. tief zu alterieren. In einem Mollakkord funktioniert das überhaupt nicht, weil sofort die Charakteristik in eine andere (meist dominantische) Richtung kippen würde. Ein Akkord auf der Subdominante hat mit der hochalterierten „11” eine ganz eigene Spannungsnote - usf.
Ich deute das nur kurz an und breche ab, bevor mir nur noch die Spezialisten folgen können. Ich will an dieser Stelle nur darauf hinaus, daß in der Akkordstruktur eines Stückes jeder Ton eine bestimmte Spannung erzeugt, die man kennen muß, wenn man nicht an dieser Struktur vorbeispielen will. Eine Note, die im erwähnten viertaktigen Beispiel in C-Dur im ersten Akkord völlig spannungslos war, kann im nächsten Akkord plötzlich zu einer scharfen Tension werden, womöglich sogar „falsch” sein (im Sinne von: zerstörerisch für den Charakter des Akkordes). Es bleibt also nichts übrig, als sich für die Übergänge zu interessieren - wenn man dies tut, hat man sich zur Belohnung noch gleichzeitig vom vertikalen Denken verabschiedet, das dazu verführt, Skalen (oder auch Akkordbrechungen) hoch und runter zu daddeln, und ist dabei, sich in horizontalen Linien zu bewegen – in Melodien also.
Eine gute Möglichkeit, dieses Denken vorzubereiten und zu trainieren, besteht in der Beschäftigung mit sog. „Guidelines”. Darunter versteht man Notenfolgen, die mit minimalen Sprüngen (Halb- oder maximal Ganztönen - bestenfalls läßt man den Ton unverändert liegen) durch eine Akkordstruktur führen. Dabei gilt: pro Akkord eine Note, und die komplette Linie soll sich auf ein und demselben „Spannungsplateau” bewegen, also z.B. nur aus Terzen, Septen oder Nonen bestehen. Man wird entdecken, daß dies – im Bereich der Funktionsharmonik – immer funktioniert, und daß es idR. sogar mehrere Lösungen gibt. Man kann daraus rasch Improvisationen ableiten, indem man eine Guideline mit leitereigenem Material verziert und umspielt - besser noch: man kann auch chromatische Vorhalts- oder Wechselnoten verwenden, die sich um die Tonart oder Skala überhaupt nicht scheren brauchen. Wenn man dann noch zwischen zwei oder noch mehr Guidelines hin und her pendelt, dabei dann womöglich gezielt die Spannungsebenen durchläuft, kommt man zu Ergebnissen, die – ohne große technische oder virtuose Mätzchen – überaus logisch und kraftvoll klingen.
Ich tippe auch dies nur kurz an, weil ich hier nur darauf verweisen will, daß es Techniken gibt, sich horizontal durch Akkorde zu bewegen, ohne in einem ständigen Auf und Ab Skalen oder Brechungen zu durchlaufen. Dabei – und hierauf kommt es mir an – kommt man in die Lage, tatsächlich zu improvisieren, d.h., aus dem Stegreif Musik zu erfinden. Das geschieht auch hier nicht unvorbereitet aus dem Nichts – bei der Variation von Guidelines ist man aber überraschend frei, und kann mit nur wenigen Mustern eine Fülle neuer Musik erfinden.
Guidelines

Hier sind die ersten vier Takte aus „All the Things You Are”, wobei die roten bzw. blauen Noten jeweils in „Guidelines” durch die Akkorde führen. Sie bestehen aus Terzen bzw. Septen, jenen Intervallen also, die den Akkorden ihre „Farbe” geben. Tatsächlich hat man, wenn man die beiden Guidelines gleichzeitig und mit dem dazugehörigen Grundton auf dem Klavier spielt, bereits eine rudimentäre Klavierbegleitung für die Akkorde - man kann so klar die Grundstruktur der Funktionsharmonik hörend nachvollziehen.
Das ist übrigens ein grundsätzlicher „Trick”, mit dem man sich Akkorde verständlich machen kann, selbst ohne großartig Klavier spielen zu können - Grundton plus Terz plus Septe, wobei man die beiden letzteren so dicht wie möglich in jene des nächsten Akkords überführt (die Septe liegt dann öfters unter der Terz).

Eine Möglichkeit, eine Guideline in eine Melodie zu verwandeln, könnte z.B. so aussehen wie im Notenbild nebenan - die blauen Noten sind die ursprüngliche Guideline, die restlichen umspielen sie mit leitereigenem bzw. chromatischem Material. Man muß sich um die eigentlich zugrunde liegenden Skalen nicht kümmern - sich selber zuzuhören reicht völlig, und es ist kaum möglich, versehentlich wirklich falsch klingende Töne zu spielen, so lange man dicht genug an der Guideline bleibt.[1]

Soweit ist das noch eher harmlos, und erinnert mehr an Swing als an moderne Stilistiken. Mit einer Guideline wie rechts dargestellt ändert sich das bereits. Hier kommen Tensions (Spannungstöne) ins Spiel, die schon eher an Hard- oder Bebop denken lassen. Dabei kann man aber ebenso Durchgangs- oder Wechselnoten verwenden, wie im Beispiel oben - man kann also gewissermaßen Kinderlieder spielen, die sich in hoher Spannung zu den Akkorden befinden.
Damit ist es natürlich nicht getan. Manchmal will man sich mit fließenden Achteln oder mit schnellen Läufen in Double-Time (auf der Sechzehntel-Ebene) bewegen und es eben nicht bei einem engen Tonraum bewenden lassen. Trotzdem ist das Denken in gemeinsamen oder eng beieinander liegenden Noten quer durch die Changes die Grundlage auch für virtuosere Spielweisen. Auch hier wird man nämlich die Übergänge zwischen den Akkorden mit Guidelines gestalten, selbst wenn man innerhalb eines Akkords große Sprünge macht.
- [1] Selbst wenn man das »F« im ersten Takt durch ein »E« ersetzt, würde das akzeptabel klingen, und zwar auch dann, wenn man die Linie so ändert, daß das »E« explizit betont wird und auch länger klingt als das »F« im Beispiel. Das wäre die große Septe in einem Mollakkord mit kleiner Sept - laut Skalentheorie ist das ausgerechnet jener Ton, der nun überhaupt nicht geht.
Pentatoniken
Das Material für virtuosere Läufe und Figuren besteht aus Skalen und Akkorden, wobei ich das Hoch- und Runtergespiele von Tonleitern für denkbar uninspiriert und langweilig halte - das praktizieren auch nur Musikschüler und Brian May.
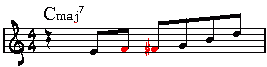
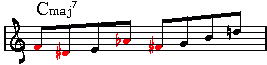
Auch bei Akkordbrechungen schadet es nicht, die Töne nicht nur hoch- und runter zu marschieren, sondern sie mit Durchgangstönen zu versehen (1. Beispiel) bzw. chromatisch zu umspielen. Dabei kann man jede Note von oben, von unten oder sowohl von oben wie unten (2. Beispiel) mit einem Halbton ansteuern, ohne sich um die Skala kümmern zu müssen.
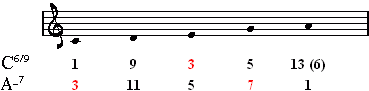
Eine dritte Alternative (zu Skalen und Akkorden) findet sich in Pentatoniken (penta = fünf), die, wenn man sie ein wenig naiv spielt, an chinesische Musik erinnern (welche tatsächlich auf ihnen basiert). M.E. sind sie Skalen überlegen, weil sie mit ihren beiden Terzsprüngen schon fast wie eine kleine Melodie klingen und von Haus aus eine gewisse Lebendigkeit in sich tragen. Man kann sehen, daß eine Reihe von wichtigen Tönen aus dem zugrunde liegenden Akkord auftauchen - Grundton, Terz und Quinte - auch die restlichen Töne „passen” zum Akkord, ohne übermäßig spannungsvoll oder „falsch” zu sein. Man hat es mit einer Art Zwitter zu tun - etwas wie einer „melodischen Akkordbrechung”.
Im Jazz sind es jedoch Terz und Septe, die den Charakter eines Akkordes ausmachen und in den Sololinien wichtig sind. Ein Saxophon wird kaum je den Grundton spielen und damit den Baßton verdoppeln; ebenso spannungslos ist die Quinte. Noch interessanter sind sogar die höher liegenden Tensions, weil hier die meiste Spannung zu holen ist, ohne sich völlig aus dem tonalen Rahmen zu begeben.
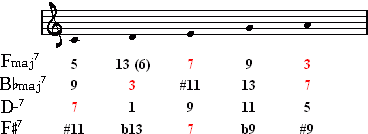
Wie man in den nebenstehenden Noten sehen kann, bietet es sich an, die C-Dur-Pentatonik nicht über C-Dur, sondern über ganz andere Akkorde zu spielen (Terz und Septe sind jeweils rot markiert). F-Dur ist die naheliegenste Lösung; Bb-Dur geht nur dann, wenn es als Subdominante auftaucht (wegen der „lydischen” #11); D-Moll ist eher schwach, und F#7 nichts für schwache Nerven, ist dort doch jede denkbare Alterierung ausgeschöpft.
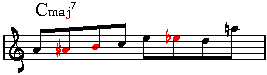
Bei Pentatoniken kann man dasselbe Spiel betreiben wie mit Akkorden, und sie mit chromatischen Durchgangs- oder Vorhaltsnoten anreichern. Das klingt zunächst durchaus gewöhnungsbedürftig, weil man sich quer durch die unterschiedlichen Spannungsebenen bewegt, und sie nicht schön brav in einer Richtung durchwandert. Der Effekt ist aber in sich logisch und klingt sehr farbig (ich bin der Meinung, daß eine ganze Reihe von Musikern aus dem ECM-Umfeld - namentlich Pat Metheney - mit solchen Konzepten arbeiten).
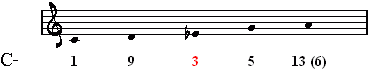
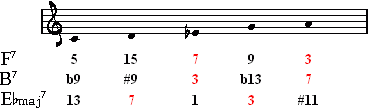
Problematisch ist hier allenfalls, daß man keine Möglichkeit hat, über Dominant-Sept-Akkorde zu spielen (von der wenig befriedigenden Lösung in Zeile 4 - F#7 -abgesehen). Ich habe in einem Buch von Adelhard Roidinger den Vorschlag gefunden, Pentatoniken zu alterieren (ich weiß nicht, ob die Idee von Roidinger ist, oder ob auch er das Konzept eines anderen vorträgt). Nebenstehend findet sich eine von mehreren Varianten. Diese Pentatoniken klingen schon in sich sehr ungewöhnlich und haben einen ganz eigenen Sound. Hinzu kommt, daß sie eine Reihe sehr interessanter Möglichkeiten bieten, über Dominanten zu improvisieren.
Pentatonische Strukturen
Skalen, Akkordbrechungen und Pentatoniken sind zunächst einmal nur rohes Material und zu wenig strukturiert, als daß man nur die in ihnen enthaltenen Töne kennen und auf seinem Instrument wiederfinden müsse, um damt improvisieren zu können. Es braucht Bausteine, die man systematisch üben kann, und die man später spontan zu Linien aneinanderfügt, die man in dieser Form zuvor noch nicht gespielt hat. Solche Bausteine findet man, indem man das Material in Gruppen ordnet, die sich zu Sequenzen verknüpfen lassen.


Nebenan sieht man die C-Dur-Pentatonik in Gruppen zu vier Tönen: vier Töne nach oben, dann zurück auf den nächsten Ton der Pentatonik und wieder vier Töne nach oben (jeder vierte Ton bildet also wiederum eine C-Dur-Pentatonik). Darunter sieht man dasselbe Schema, nur von oben nach unten.


Die dritte und vierte Variante für die „Vierer” sieht so aus, daß man den rhythmischen Einstieg verschiebt, und zwar um eine Achtel nach vorne auf den Off-Beat.

Als nächstes kann man sich „Dreier”-Gruppierungen ansehen - man benutzt dasselbe Schema wie oben, nur sind es jetzt immer drei Noten, bevor nach unten in den nächsten Ton der Pentatonik gesprungen wird. Die „Dreier” kann man genauso variieren wie die „Vierer”, also von oben nach unten spielen, und den rhythmischen Einstieg verändern. Dabei sind sie rhythmisch recht interessant, weil der Punkt des Wechsels ständig zwischen Down- und Off-Beat pendelt. - Dieselben Schemata funktioniert auch für Gruppen aus fünf oder mehr Tönen.

Einen „Zweier” gibt es auch - dann muß man aber immer einen Ton auslassen. Auch hier kann man hoch und runter spielen und mit einem Down- oder Off-Beat beginnen.

Das Spiel mit dem „Auslassen” von Tönen kann man auf andere Gruppierungen ausdehnen - im Beispiel rechts geht geht es drei Töne aufwärts, wobei jeder zweite Ton ausgelassen ist, und danach - um einen Ton in der Pentatonik verschoben - wieder abwärts.

Und so weiter - man kann sich etliche weitere Konstrukte ausdenken, die ähnlichen Regeln folgen. Dann kann man noch Gruppierungen bilden, die systematisch chromatische Zwischen- und Wechselnoten enthalten. Nicht zuletzt läßt sich all dies auch auf die alterierten Pentatoniken übertragen - das ergibt schon allein deshalb interessante Bausteine, weil hier teilweise sehr spannungsreiche Intervalle bei den Sprüngen entstehen (vermindert Quinte, große Septe).
Der vorgestellte „Bausteine”-Ansatz hört sich zunächst an wie pure Theorie, die keine praktische Bedeutung hat. Tatsächlich ist allein der Umfang des Materials (das ich hier nur andeutungsweise skizziert habe) derart gewaltig, daß man sich kaum vorstellen kann, daß man es einüben und tatsächlich in einem Solo verwenden kann. Zur Vielgestalt der erwähnten Muster kommt ja hinzu, daß man sie in allen zwölf Tonarten beherrschen muß - und zwar gestartet von jedem der fünf Töne der Pentatoniken. Schließlich hilft es wenig, wenn man auf einen Akkordwechsel trifft, für den neuen Akkord auch das neue Material weiß, aber nur mit einem Sprung dorthin wechseln kann, weil man es nur von Grundton zu Grundton spielen kann.
Es gibt einen weiteren zentralen Einwand, der dagegen spricht, daß man es hier mit einem Modell zu tun hat, das für echtes Improvisieren taugt. Schließlich muß man nicht nur das Material und die Übergänge geübt haben, sondern man muß das alles auch noch so verinnerlichen, daß es völlig spontan abrufbar ist. Ein bewußtes Abrufen einer bestimmten Folge ist letztlich nichts anderes als das Abfeuern eines zuvor einstudierten Patterns. Wenn man tatsächlich mit diesen (und ähnlichen, anderen) Konzepten improvisieren will, müssen sie so selbstverständlich sein wie das Spielen einer C-Dur-Tonleiter - und zwar in der kompletten Komplexität, die dadurch entsteht, daß man zwischen Gruppierungen und verschiedenen Tonarten nahtlos wechselt.
Dennoch ist dies möglich - allerdings um den Preis, wirklich viel am Instrument zu arbeiten. Von Mike Brecker ist bekannt, daß er streckenweise acht Stunden täglich mit dem Saxophon im Kleiderschrank gestanden hat, um die Nachbarn nicht zu veranlassen, die Polizei zu rufen - und Pat Metheny hat nach einem Auftritt den Abend nicht etwa an der Hotelbar ausklingen lassen, sondern sich in sein Zimmer zurückgezogen, um Gitarre zu üben.
Superstructures
Ich hatte gerade behauptet, daß, wenn man sich durch eine Akkordverkettung hangelt, man sich auf ein und derselben Spannngsebene bewegen und nicht unvermittelt z.B. von einer spannungslosen Quinte in eine „Upper Tension” springen sollte. Man kann das in einen systematischen Zusammenhang bringen, der sich recht gut praktisch nutzen läßt.

In Akkorden lassen sich andere Akkorde finden.
Nebenan steht ein C-Dur mit großer Septe. Wenn man diesen Akkord von der Terz aus liest, sieht man einen E-Moll-Akkord. Damit liegt es nahe, daß man über Cmaj7 eine E-Moll-Pentatonik spielen kann. Wenn man dies tut, vermeidet man „automatisch” den Grundton (das C), und damit den spannungslosesten Ton von allen.

Es folgt nochmals C-Dur, diesmal um alle sieben Terzen erweitertet (bevor sich mit der achten Terz der Grundton wiederholt). Die „11” ist hier die lydische „#11” (das „F” sollte man vermeiden, weil es im Intervall einer kleinen None zum „E” der Terz steht, was zum weglaufen klingt). „Ganz oben” findet sich jetzt ein H-Moll-Akkord, über den man natürlich die H-Moll-Pentatonik spielen kann.

Das nächste Beispiel ist ein (leicht) alterierter A7-Akkord, über dem sich ein F#-Dur Akkord findet. Hier wäre eine F#-Dur-Pentatonik sicher nicht am Platz, weil sie mit dem „G#” den einzigen Ton enthält, den man über einem Dominant-Akkord auf gar keinen Fall (in betonter Form) bringen sollte - die große Septe. Wenn man hier jedoch Figuren spielt, die lediglich aus Brechungen des reinen F#-Dur-Dreiklangs bestehen, bekommt man eine derart interessante Farbe, daß es plötzlich Sinn zu machen scheint, Brechungen von Dur-Dreiklänge zu üben.
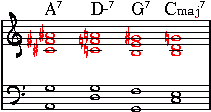
Man kann Akkordfolgen auf solche „Akkorde in Akkorden” - sog. Superstructures - abklappern, und dort ganz neue Folgen finden, über die man dann seine Improvisation spinnen kann. Der Vorteil liegt dabei darin, daß man ein in sich konsistentes Spannungsgefüge schaffen kann, ohne sich ständig bewußt sein zu müssen, wo die Tensions nun genau liegen. Man spielt auf einmal wieder über letztlich sehr einfaches Material, nämlich Drei- oder Vierklänge, obwohl man in erheblicher Spannung über die Changes unterwegs ist.
Wohlbemerkt - ich sage nicht, daß man sich über die Lage der Tensions nicht bewußt sein muß. Bei schnellen Läufen ist aber die Forderung illusorisch, man müsse jeden Ton einzeln planen - da geht es darum, vorab geübtes Material abzuspulen. Wenn man dies tun will, ohne sich ständig in Patterns zu wiederholen, geht es aber nicht ohne solche Simplifizierungen und Automatismen.
Inside-Out
Der letzte Schritt besteht dann darin, sich aus den Superstructures der höchsten Spannungslevel noch hinaus zu begeben, und „Inside-Out” zu gehen. Dabei verläßt man den tonalen Rahmen und spielt bewußt „falsche Noten”, die die zugrunde liegenden Akkorde selbst nach wildester Alteration nicht mehr hergeben. Die Idee ist, daß man eine bestimmte strukturelle Idee „inside” - innerhalb der tonalen Grenzen - beginnt, sie über eine gewisse Strecke „outside” fortführt, um sie schließlich „inside” abzuschließen.
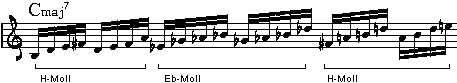
Im Beispiel beginnt eine Linie über einem Cmaj7-Akkord mit einer H-Moll-Pentatonik, die in Vierer-Gruppen aufwärts geführt wird. Ohne Unterbrechung und unter Beibehaltung der „Vierer”-Struktur geht es in einer Eb-Moll-Pentatonik (die die maximal mögliche Zahl von „falschen Tönen” enthält) weiter, um kurz darauf nach H-Moll zurück zu kehren.
Baßsolo
Ein wichtiger Punkt soll noch erwähnt werden, dessen Bedeutung man gar nicht unterschätzen kann, obwohl er bislang noch in jeder Harmonielehre fehlt: das Material, das für ein bestimmtes Instrument verfügbar ist, unterscheidet sich stark je nach der Lage im Tonraum, in dem dieses unterwegs ist.
Meine Ausführungen über „Superstructures” und „Inside-Out” sind vergleichsweise mager geraten, einfach weil ich als Bassist nur wenige Gelegenheiten gefunden habe, wo man sie auf meinem Instrument wirksam unterbringen kann. Normalerweise wird ein Baßsolo von einem eher zurückhaltend gespielten Schlagzeug und sparsamen Einwürfen durch das Klavier begleitet. Das Fundament der Grundtöne verschwindet jetzt völlig, und auch die Logik der Akkordfortschreitungen läßt sich eher erahnen als wirklich hören. Wenn man jetzt auf dem Baß auch noch in die Tensions einsteigt, wird das leicht ein chaotischer Haufen von Tönen, die keiner erkennbaren Logik folgen. Viele Baßsoli verwenden deshalb Tonmaterial, das auch für die Begleitung taugt - nämlich (im Schwerpunkt) Grundton und Quinte -, ohne daß sie dadurch spannungslos oder altbacken wirken.
Umgekehrt läuft das Solo eines hohen Instruments (Saxophon, Trompete) leicht in Gefahr, wie ein Abklatsch der Improvisationen im Swing zu klingen, wenn es sich auf den Bereich der Terz und Septe beschränkt. Damit verdoppelt es letztlich nur jene Töne, die auch das Klavier in seiner Begleitung hervorhebt und betont. Erst recht gilt dies angesichts einer Begleitung, die mit Akkorden arbeitet, in denen stark alterierte Töne oder solche aus den „Upper Structures” verwendet werden. Dann kann es regelrecht falsch klingen, wenn das Solo im Tonraum darüber auf den Basisintervallen herumreitet - hier sind ausgiebige Konzepte für Inside-Out geradezu verpflichtend.
Hören lernen
Im Grunde muß man mit den angedeuteten Konzepten praktisch arbeiten, um Sinn oder Unsinn beurteilen zu können. Man muß dabei nach und nach, über mehrere Jahre, ein Ohr entwickeln für das, was gut klingt bzw. was man lieber unterlassen sollte - man muß buchstäblich hören lernen.
Das geht los damit, daß jeder Musiker, der etwas auf sich hält, eine umfangreiche Sammlung von Musik besitzt, die er aber - anders als der Sammler von MP3-Files, der Gigabytes aus dem Netz gesaugt und allenfalls einen Bruchteil seiner Schätze auch nur einmal angehört hat - buchstäblich auswendig kennt. Wenn ich eine CD in die Hände bekomme, die mich interessiert, höre ich sie teilweise dutzende Male - und zwar nicht verteilt über einen langen Zeitraum immer mal wieder, sondern innerhalb weniger Wochen solange, bis ich kapiert habe, worauf mein Interesse basiert.
Zum anderen muß man lernen, sich selber zuzuhören. Das ist weit schwieriger, als man sich das gemeinhin vorstellt, weil es - wenn man die Forderung wirklich ernst nimmt - darauf hinausläuft, daß man auch den anderen Instrumenten in der Band zuhört. Ich nehme mein eigenes Spiel schließlich nur dann richtig wahr, wenn ich z.B. erkenne, in welchem tonalen Bezug ich mich gerade zum Piano befinde bzw, wie meine rhythmische Bewegungen in Relation zu jener des Schlagzeugs stehen - dazu muß ich natürlich Piano und Schlagzeug wahrnehmen, und das ist - so verrückt das klingt - richtig, richtig schwer.
Es fängt schon damit an, daß man, wenn man die täglichen technischen Übungen abspult, seine Ohren nicht einfach im Regal mit dem überflüssigen Zubehör ablegt. Es ist zwar anstrengend, sich dieselbe Figur wieder und wieder anzuhören, es lohnt aber, der Verführung zu widerstehen, abzuschalten und die Finger mechanisch laufen zu lassen. Man muß sich klar machen, daß man, wenn man übt, alles übt, und zwar auch die Fehler. Wenn man bspw. Läufe zu rasch angeht und sich immer wieder verhaspelt, ist die Chance groß, daß man diese Verhaspler später nie mehr los wird. Gleiches gilt für die Gewohnheit des Weghörens: wer einmal damit beginnt, seinem eigenen Spiel nicht mehr hoch konzentriert zuzuhören, wird dies auch später immer wieder tun.
Es geht dann aber um die Wahrnehmung der Mitmusiker. Ich habe es dutzendfach erlebt, daß bei Jamsessions - aber auch auf regulären Konzerten, für die man viel Eintritt bezahlen mußte bzw. für die ich eine Gage bezahlt bekam - die Leute auf engstem Raum auf der Bühne beieinander standen, und letztlich miteinander nichts zu tun hatten. Das ging soweit, daß man über mehrere Choruse umgestiegen war (d.h., man hatte keinen gemeinsamen Taktanfang mehr), ohne daß auch nur der Versuch unternommen wurde, wieder zueinander zu finden. Die absolute Regel ist zumindest, daß der Schlagzeuger hin und wieder einen Break einwirft, der Bassist seinen „Walkin'” abspult, und ein Solo aufs nächste folgt, ohne daß die Rhythmusgruppe auch nur in Nuancen darauf reagiert und ihre Begleitung variiert - täte sie dies, würden sich die Solisten das übrigens eh verbitten.
(Zu dem Thema wird noch einiges zu sagen sein, zumal es die Fälle, wo wirklich spürbar wird, daß die Bandmitglieder aufeinander reagieren, natürlich ebenfalls gibt. Ich vertage das auf einen Zeitpunkt nach einer Darstellung der Ebene der Rhythmik.)
Training
Was ich bisher zur Improvisation über „Changes” gesagt habe, ist in keiner Weise vollständig. Mir ging es nicht darum, so etwas wie ein Lehrbuch zu dem Thema zu beginnen, sondern ich wollte lediglich einige grundsätzliche Dinge beschreiben, aus denen ersichtlich wird, daß Improvisationen über komplexe Akkordverbindungen durchaus möglich sind. Es gibt Konzepte, die es erlauben, aus dem Stand heraus höchst komplexe Musik zu erfinden - wie sie im einzelnen aussehen, war nur am Rande das Thema.
Dabei sind sie nicht von mir, sondern aus verschiedenen Ecken zusammengetragen. Das sind einige wenige Lehrbücher, Anregungen aus meinem Unterricht an der Uni, vor allem aber der langjährige Versuch, das Spiel der bewunderten Vorbilder darauf abzuklopfen, wie es wohl gemacht ist, in einem Wechselspiel zwischen dem Hören fremder Musik und Experimentieren am eigenen Instrument.
Meine Darstellung entspricht keiner Lehrbuchmeinung und einige Ausführungen dürften auch zu Widerspruch herausfordern. Außerdem habe ich einige Aspekte bewußt überpointiert, um klar zu machen, worauf ich hinaus will. Meine Abneigung gegen Skalen beispielsweise findet durchaus ein Ende, wenn es um alterierte Skalen wie „Halbton-Ganzton” geht, die durchaus eine eigene Farbe mit sich bringen und in der (guten) Praxis häufig auftauchen.
Die entscheidende Beobachtung - jenseits aller konkreten Beispiele - scheint mir, daß man das Material in irgend einer Weise systematisch ordnen muß, um es in den Griff zu bekommen. Wenn man eine Sequenz nur in einer bestimmten Tonart kann, oder nur über eine begrenzte Auswahl an Sequenzen verfügt, spielt man letztlich wieder nur Patterns - wobei die vorgestellten Sequenzen, für sich genommen, sogar eher langweilig sind. Erst wenn man über einen gewissen Umfang an Material verfügt, kann man das so zusammensetzen, daß man sich nur noch selten wiederholt.
Ein zweiter abschließender Punkt ist, daß man das Material solange üben muß, bis es ins Unterbewußte wandert. Bewußtes Abrufen von bestimmten Mustern führt letztlich wieder dazu, daß man festgelegte Patterns abfeuert, und nicht mehr spontan auf den Kontext reagiert, der im Zusammenspiel mit den anderen Bandmitgliedern entsteht. Tatsächlich ist es mir regelmäßig passiert, daß ich bestimmte Sachen über Monate immer wieder geübt hatte, bevor sie endlich in einem Konzert oder bei einer Probe in den Fingern auftauchten. Manchmal habe ich Übungen einige Zeit beiseite legen müssen, um ihnen eine Chance zu geben, „in den Bauch zu wandern” - erst dann haben sie das Zeug, zum Bestandteil einer Improvisation im engeren Sinne zu werden.
Timing
Es gibt ein Vorurteil, das - selbst auf dem Level von semiprofessionellen Musikern - scheinbar nicht tot zu bekommen ist, demzufolge das Schlagzeug für das Timing zuständig ist. Wenn in einer Pop-, Rock- oder Jazz-Band das Tempo gar zu sehr anzieht (langsamer wird es ja fast nie), gibt es am Ende immer böse Blicke in Richtung auf den Drummer. Nach verbreiteter Meinung liegt es in dessen Verantwortung, die Time zu halten und die Band in rhythmischer Hinsicht anzuführen.
Tatsächlich kann man - am Baß, am Piano, oder am Saxophon - gegen einen Drummer, der gnadenlos nach vorne treibt, nur schwer etwas unternehmen. Meist ist es jedoch so, daß das Schlagzeug lediglich einer allgemeinen Tendenz nachgibt, das Tempo anzuziehen. Dabei ist es zunächst gar nicht schlimm, wenn die Steigerung in einem Solo dazu führt, daß es - z.T. deutlich - schneller wird. Wenn alle das wissen und daran beteiligt sind, spricht nichts dagegen, daß man sich (gemeinsam!) am Ende wieder ebenso deutlich zurücklehnt und gewissermaßen einen neuen Anlauf für den nächsten Durchgang nimmt. Oft ist das aber nicht allen Musikern in der Band klar, und die Atempause fällt aus.
Hinzu kommt, daß verschlampte Time durch sich selber zustande kommt: durch verschlampte Rhythmik und ungenaues Spiel - und zwar von allen. Gerade dann, wenn es schnell wird, sind die wenigsten Solisten noch in der Lage, wirklich präzise zu spielen, und dann ist idR eine gewisse Hektik dafür verantwortlich, daß alle plötzlich davon eilen.
Bei wirklich großartigen Formationen kann man immer wieder heraushören, daß jeder Einzelne seinen eigenen rhythmischen Puls „im Bauch hat”, und sich lediglich mit halber Kraft darum kümmern muß, sich mit dem Puls der Anderen zu synchronisieren. Da ist dann das Schlagzeug kein in irgendeiner Weise halb mechanisiertes Metronom, an das sich der Rest der Band „dran hängt”, sondern es kann sich seinerseits völlig frei bewegen und Dinge spielen, die vor, hinter, oder völlig neben dem gemeinsamen Puls liegen.
Sehr schön nachvollziehen läßt sich das an allen Aufnahmen, bei denen Jack DeJohnette mitwirkt - er dürfte der Drummer sein, der am deutlichsten völlig neben der eigentlichen Time spielt, die HiHat scheinbar zufällig auf- und zuschlappen läßt und zuweilen völlig aus der Rhythmik auszubrechen scheint. Wenn er dann auch noch mit Dave Holland gemeinsam die Rhythmusgruppe formt, glaubt man gelegentlich, daß man Free-Jazz hört - bis man entdeckt, daß Gitarre oder Saxophon das überhaupt nicht so sehen, und nur den gemeinsamen Puls nicht ganz so frei umspielen.
Hören lernen - 2
In einer Improvisation muß man das, was man spielen will, im Vorhinein hören. Wenn man z.B. über einen C-Dur-Akkord ein „E” spielen will, hilft es wenig, wenn man nur theoretisch weiß, daß es sich um die Terz des Akkords handelt, und deshalb schon „irgendwie” passen wird. Man muß innerlich auf die Wirkung vorbereitet sein, und um die Farbe, die sich ergeben wird, schon vorher wissen. Wenn man die Spannung einzelner Töne nicht schon kennt, bevor man sie spielt, ist es letztlich unmöglich, so etwas wie einen Spannungsbogen aufzubauen, der von einem Ton über den nächsten immer weiter reicht. Andernfalls wäre man nur am Raten, ob das, was man als nächstes zu spielen plant, in einem „sinnvollen” Verhältnis zu dem stehen wird, was man gerade spielt und hört. Man muß dieses Verhältnis antizipieren, um so etwas wie einen Anschluß zu finden, in dem die einzelnen Töne sich zu einer nahtlosen „Erzählung” verdrahten.
Man kann das auch umdrehen: was man nicht hört, kann man auch nicht spielen. Das gilt zumindest dann, wenn man unter „Spiel” kein sinnloses Gedaddel versteht, sondern einen kontrollierten Umgang mit dem eigenen Instrument und dem musikalischen Material, bei dem dann etwas beim Hörer ankommt, das „Sinn” nicht bloß behauptet. Auch ein Anfänger kann auf einem Klavier mit den Fäusten herumhauen. Ein Cecil Taylor, der gelegentlich dasselbe macht, unterscheidet sich von diesem letztlich nur dadurch, daß er es hört, bevor er es tut - er hat eine klare Vorstellung vom Klang, bevor er ihn produziert.
Das gilt auch im Bereich der Rhythmik. Jemand, der die Offbeats nicht innerlich hört, die er spielt, ist nur am Schwimmen: er probiert letztlich nur auf gut Glück, ob er sie trifft. Normalerweise bewegt sich ein Solist im Jazz ja im Kontext einer Gruppe, in der das Schlagzeug ein leicht erkennbares Metronom ersetzt. Wenn das entfällt - etwa, weil der Solist plötzlich alleine spielt, oder das Schlagzeug eben keinen Metronomersatz mehr bietet, sondern sich an den Improvisationen beteiligt - erweist sich erst, ob ein Virtuose sich tatsächlich souverän auf der rhythmischen Ebene bewegt, oder ob er das Spiel im „Groove” nur simuliert.
Ich hatte in meinem Studium einen Kurs belegt[1], in dem über mehrere Semester genau eine Sache trainiert wurde: Downbeats klatschen (oder klopfen), während von einem Metronom Offbeats kommen. Wenn man Offbeats wirklich hören kann, sollte es ja kein Problem sein, die dazugehörigen Downbeats zu markieren. - Es ist außerordentlich aufschlußreich, das mal praktisch zu testen.

Das Beispiel beginnt mit einem stumpfen Disco-Rhythmus - Bassdrum auf 1+3, Snare auf 2+4, und die HiHat mit 16teln. Bass+Snare verschwinden nach 4 Takten - es bleibt die HiHat, wobei allmählich die Achtel der Downbeat-Ebene ausgeblendet werden, bis sie ganz verschwinden. Aufgabe: klatsche die Downbeats (die Achtel) immer weiter. Ich würde mich sehr wundern, wenn es jemandem auf Anhieb gelingt, diese Übung bis zum Schluß durchzustehen, ohne „umzusteigen” - sprich: statt auf den Downbeats „dagegen zu halten”, früher oder später mit der HiHat auf den Offbeats mitzuklatschen (und sie damit zu Downbeats umzudeuten). - Dabei spielt das Beispiel gerade mal im Tempo von 90 BPM. In vielen populären Stilistiken sind Tempi von 120 BPM und mehr die Regel - und wenn es schneller wird, nimmt die Schwierigkeit, die Offbeats zu hören, nicht linear, sondern quadratisch zu.
- [1] Bei Gerd Wennemuth.
